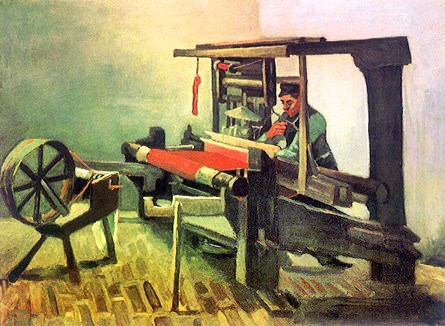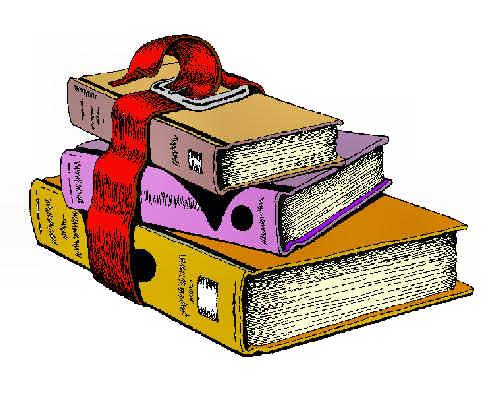Alle Beiträge von rodena
Weltkindertag – © Rodena Heimatkundeverein e.V.
Blumentraum – Bastelei für Klein und Groß mit Betty
Aktionswochen zum Weltkindertag
„Gemeinsam für Kinderrechte“
Donnerstag, den 01.09.2022 findet im Donatuszentrum, Schulst. 7, Raum 3 VHS, 66740 Roden, von 14.00 – 16.00 Uhr Blumenbasteln mit Betty statt.
Die Teilnehmer werden mit selbstgebackten Muffins belohnt.
Anmeldung bis spätesten 25.08.2022 unter den Telefonnummern: 0176 465 12 841 oder 0162 460 86 59 Rodena Heimatkundever
AUTOBIOGRAPHIE
AUTOR: Josef Theobbald
Am 6. Juli 1956 wurde ich geboren. 1963 wurde ich eingeschult.
Mein Klassenlehrer war Elmar Hein. 1/2 Jahr war ich ich Hörstein
(Unterfranken). Danach 4 Jahre in den Ordensinternaten Taben-
Rodt und Bous. Von 1972 bis 1976 war ich in der Handels- bzw.
Höheren Handelsschule in Saarlouis. Wegen meiner Behinderung
machte ich meine Berufsausbildung im Berufsförderungswerk Hei-
delberg.
1983 ist mein Großvater gestorben, bei dem ich ab 1960 wohnte.
Meine Tante und meine Anverwandten hatten mir leider das Wohn-
haus nicht gegönnt und jahrelang mich mit Pflichtteilsprozesssen
übezogen. Meine Tante hatte 1989 ihr Elternhaus übernommen.
Ich zog neben ihr altes Haus.
Von 1982 bis 1985 studierte ich an der Fachhochschule des Saar-
landes (HTW Saar) Betriebswirtschaft. 1985 wurde ich Mitglied im
Ortsvorstand des Sozialverbandes VdK und dadurch Mitarbeiter in
der Landesgeschäftsstelle in Saarbrücken.Dort war ich auch über
25 beschäftigt.
Durch mein Kurzwellenhobby bin ich in den Achtziger Jahren in die
Free-Radio-Szene gerutscht und arbeitete für RADIO VICTORIA, der
legendäre Kurzwellenmusikstation 1983-1985, als Zuträger kleiner
Beiträge, die im Free-Radio-Fanzine veröffentlicht wurden. Kurze
Zeit übernahm ich auch eine Rubrik im Radio-Kurier der ADDX e. V.
Dann schloss ich mich FM-KOMPAKT an (Gründer. THOMAS KIR-
CHER aus Heilbronn). Leider musste ich diese Arbeit wegen der
Verlegung meiner Arbeitszeit um 1 Stunde aufgeben. Nach Fei-
erabend fehlte wirklich die Zeit.
Schon während meines Studiums war ich Mitglied der Redaktion der
RENAISSANCE, einer Studentenzeitschrift.
Heute kenne ich GERD THIEL von ehemals RADIO FORUM in Forbach.
Dieser betreibt heute das Internet-Radio PMP1 und verkauft produziert
Rundfunk- und TV-Werbung (http://www.promediaplan.de.) u. a. für den
SR, Radio Salu.
Meine Interessensgebiete waren stets der Kurzwelllenempfang, die
Kirchengeschichte, chrisristliche und jüdische Theologie bzw. die So-
zialismusgeschichte. In den Siebziger Jahren war ich stark geprägt
z. B. von Radio HCJB und der Stimme der Hoffung (Voice of Hope).
Deshalb verfüge ich über ein breites Spektrum an Wisssen, das ich
von nun an in den Beiträgen für den RODENA Heimatkundeverein
einsetzen konnte. In den Achtziger Jahren erschienen zunehmend
auch jüdische Buchtitel. Das war eine ideale Grundlage für den Hei-
matkundeverein. Dort wurde ich als Schriftführer nachgewählt und
bin jetzt nun über 10 Jahre dabei.
DIE BEDEUTUNG DES ELLBACHS
AUTOR: Josef Theobald
VORWORT
Gemachte Entdeckungen in den Siebziger Jahren sorgen heute für
einigen Wirbel. Es geht um die alte Ortsbezeichnung RODONUM.
Damit eng verbunden ist endlich die leidige Diskussion um den ur-
sprünglichen Ortsnamen von RODEN.
Ich kann aber Professor Thomas Gergen aus RODEN wohl in weiten
Teilen zustimmen, wenn er ausführt:
„Natürlich besteht bei ‚Roden‘ auch der Anklang an die Farbe ‚rot‘.
In Flurnamen taucht rot, ahd., mhd., mnd., in diesem Sinne auf, so
etwa wird um 1325 ein Flurname by deme rodin steyne = beim roten
Stein überliefert. In Roden gibt es die roten Sandfelsen östlich der
Bergstraße bzw. am Park, in Richtung Dillingen die ‚Sandkaul‘. Der
Sandkaulberg (Roterberg) hatte eine Bergspitze, wo über lange Zeit
hin Kies und Sand abgetragen wurden. In Roden gab es früher zahl-
reiche Kiesgräber und Bauunternehmungen sowie eine Backstein-
und Ziegelfabrik. Zweifellos trägt der ‚Röderberg‘ als Flurname die
Farbe ‚rot‘ in sich; der Name dürfte allerdings erst im Mittelalter ent-
standen sein. Der Bach- und Siedlungsname für Roden ist indes vor-
germanisch respektive keltischen Ursprungs.“ [Roden, Rodenerbach,
Ellbach (Zur Problematik von Entstehung, Kontinuität und landesrecht-
licher Grundlage der Orts- und Gewässernamen)]
So vermute ich bei dem Namen „Rodonum“ im militärischen Sinne
eine keltische Befestigung oder Verschanzung. Da zu dieser Zeit
die gallo-römische Kultur weit verbreitet war, ist dies der wohl ur-
sprüngliche Name von RODEN. Doch hat die lateinische Sprache
im Laufe der Jahrhunderte einige Veränderungen durchgemacht,
insbesondere bei der Änderung von Vokalen. Demnach scheint
gesichert, dass der heutige Ortsnamen fränkischen Ursprungs
ist. Denn bei den Franken lebte die römische Kultur weiter fort.
Nicht umsonst waren viele Franken in römischen Diensten.
BEITRAG
Vor der Urbarmachung des RODENER Bannes war das heutige
Siedlungsgebiet ein Auwald oder ein Feucht-Biotop. Hier gab es
einen Lebensraum, der von einer Lebensgemeinschaft oder von
einer bestimmten Organismenart besiedelt war. Somit können wir
heute hier von einem frühen Ökosystem sprechen. [1]
So gibt dieser Auwald RODEN seinen eigentlichen Namen. RODEN
ist eine Ableitung vom keltischen „roudo-„, das dem deutschen Wort
„rot“ entspricht. [2] Neben der Farbe „rot“ hat dieser Terminus auch
die Bedeutung von „Roth“ (Rode), das auf dichtes Gebüsch, Unter-
holz oder auf einen Wildzaun hindeutet. Sonst ist an eine Rodung
oder an ein gerodetes Gebiet (althochdeutsch: „rod“) zu denken. [3]
Seinen Namen hat der ELLBACH von den Erlen- oder Ellernbäumen
(norddeutsch) am Bachufer. Im Singular trägt diese Baumart den bo-
tanischen Namen „alnus“.
Vor der Begradigung des Bachbettes in den Siebziger Jahren im
Rahmen des Hochwasserschutzes konnte man hier auch noch
von einem natürlichen und idyllischen Bachlauf sprechen, der
allerdings regelmäßig im Frühjahr durch die Gefahr häufiger
Überschwemmungen betroffen war. So hatten nicht wenige
Häuser Wasser im Keller, außer die jeweiligen Hauseigentümer
hatten die Bachufer vorher künstlich mit Schutt oder Sand höher
gelegt. Durch die höheren Böschungen und die Schutzmauern
sank allerdings der Grundwasserspiegel erheblich, was Risse
an den Giebeln einiger Häuser mit sich brachte. Schließlich in
den Achtziger Jahren fanden hier von der Bundesanstalt für
Wasserbau in Karlsruhe durchgeführte Bohrungen statt.
Am ELLBACH finden sich seit dem 16. Jahrhundert erste
Mühlenbetriebe, wie die Kirchen- oder Abelsmühle (1593).
Infolge des in RODEN betriebenen Gerberhandwerks ist
bereits für das Jahr 1618 eine Lohmühle nachweisbar. Im
Jahr 1685 wurde am Unterlauf des Baches eine zweite Loh-
oder Gerbmühle errichtet. Als Hintergrund hierfür stand offen-
bar ein gesteigerter Bedarf an Lohe-Material. Im Jahre 1886
wich sie wieder einer Ziegelei, die schließlich aber 1976 ab-
gerissen wurde (Ziegelei Diete). Die spätere Böttler-Mühle
wurde wahrscheinlich um das Jahr 1750 gebaut und hatte
im Laufe der Zeit verschiedene Besitzer. Anfang der Acht-
ziger Jahre mussten die Gebäude dieser Mühle einer Neu-
bausiedlung weichen. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts
entstand am Zufluss in die Saar die Saarmühle, die 1872
umgebaut und modernisiert wurde. 1927 ist allerdings die
Mühle bis auf die Grundmauern niedergebrannt und nicht
wieder aufgebaut worden. Die wohl bekannteste Mühle ist
die seit 1767 überlieferte Schillesmühle (Mühle des Jakob
Schille). In der preußischen Zeit arbeitete sie hauptsächlich
für das Proviantamt. Nach dem I. Weltkrieg verlor sie ihren
Absatzmarkt und ging fast gänzlich ein. Eine kurze Blütezeit
erlebte sie während des II. Weltkrieges, als sie modernisiert
und technisch erneuert wurde. Durch die Kriegswirren wurde
die Mühle allerdings wieder zerstört.
Als im Jahre 1866 in RODEN nun eine verheerende Cholera-
Epidemie auftrat (Ursache war mangelnde Hygiene), besann
man sich auf die Reinigungswirkung des Wassers und baute
vor der Eingemeindung nach Saarlouis (1907) ein Wasserwerk
am Oberlauf des ELLBACHs mit dem Anschluss eines Systems
von Kanal- und Wasserversorgungsanlagen, dessen Überreste
man heute noch betrachten kann. [4]
NACHTRAG
Im Laufe der nachchristlichen Jahrhunderte ist die Befestigung
„Rodonum“ aufgegeben worden und die Ortsmitte auf den heu-
tigen Marktplatz verlegt worden. Frühere Ausgrabungen beleg-
ten unter der alten Pfarrkirche eine römische Kultstätte. Wie wir
wissen, wurden solche Gebäude in unseren Regionen nicht ab-
gerissen, sondern als Monumente aus der Vorzeit erhalten. Die
Kultstätten, die als Tempel direkt den Göttern gewidmet waren,
wurden hier ab dem siebten Jahrhundert der Verlassenheit an-
heimgegeben. Nachdem diese Relikte aus früherer Zeit doch
verfielen, ging man daran, die bestehenden Fundamente wie-
der durch Gebäude mit christlicher Symbolik auferstehen zu
lassen. [5]
ANMERKUNGEN
[1] Meyers Lexikon der Naturwissenschaften, Meyers LEXI-
KONVERLAG, Mannheim 2008, Seite 81.
[2] Bernhard Maier, Kleines Lexikon der Namen und Wörter
keltischen Ursprungs, Verlag C. H. Beck, 3. Auflage 2010,
Seiten 102/3.
[3] Historisches Siedlungsnamensbuch der Pfalz, Verlag der
Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften,
Speyer 1991, Seiten 401 + 394.
[4] Geschichte der Kreisstadt Saarlouis, Band 6: Roden
(Traditionsbewusstes Dorf und moderner Stadtteil), Autor:
Marc Finkenberg, Herausgeber: Kreisstadt Saarlouis (1997),
die Seiten 81, 82 + 124.
[5] Hartmann Grisar, Geschichte Roms und die Päpste im Mit-
telalter, Erster Band: „Rom beim Ausgang der antiken Welt“,
im Nachdruck des Georg Olms Verlages, Hildesheim usw. 1985,
Textnummern 11 + 12.
KATHARINA KEST – DIE LETZTE SCHLOSSHERRIN IN DILLINGEN
AUTOR: Josef Theobald
In einem Prolog zu einer saarländischen Sage heißt es: „Die Fürstin
Katharina von Nassau-Saarbrücken, als welche sie in Saarbrücken
vollkommen anerkannt und tituliert worden ist, der das Volk den po-
pulären Namen des ‚Gänsegretel’s von Fechingen‘ gegeben hat, war
von einfacher, ja dörflicher Herkunft und stammte aus der Familie Kest
(Köst) von Fechingen. In ihrer Jugend war ihr von einer Zigeunerin ge-
weissagt worden, dass sie einmal einen Witwer heiraten würde, der sie
zur ersten Frau im Lande machen würde.“ [1]
Nachdem die Burg in Dillingen mehrmals den Besitzer wechselte, erwarb
1798 Fürst Ludwig von Nassau-Saarbrücken für 225.000,– Franken das
Schloss und ließ dieses nach den Plänen seines Baumeisters Balthasar
Wilhelm Stengel von dem Werkmeister Johann Adam Knipper wiederher-
stellen, die Herrschaft zum Herzogtum erheben und schenkte es seiner
zweiten Frau, der Katharina Margarethe Kest von Fechingen, seit 1783
Reichsgräfin von Ottweiler. [2]
In der Historie der Grafen und Fürsten von Nassau-Saarbrücken steht
Fürst Ludwig (1768-1793) in der Bedeutung hinter seinem Vater Fürst
Wilhelm Heinrich. Er habe sich in der Hauptsache darauf beschränkt,
das spielerische Dasein eines Rokokofürsten zu genießen, sich an
Jagd, Theater und Soldatenspielerei ergötzend und das Regieren
im wesentlichen seinen Räten überlassend. Während seiner Zeit
wurde die Arrondierung der Grafschaft Saarbrücken weitergeführt.
Auch war Fürst Ludwig der letzte regierende Herrscher. Vor den
Wirren der Französischen Revolution fliehend, starb dieser am
2. März 1794 in Aschaffenburg. [3]
Die Beliebtheit, die also dem Fürsten Ludwig fehlte, brachte die
zweite Frau Katharina Margarethe Kest mit. Georg Baltzer hat
in seinem Buch „Historische Notizen über die Stadt Saarlouis
und deren unmittelbare Umgegend“ eine kleine Biographie
angefügt: „Sie war geboren zu Fechingen am 1. März 1757,
stammte aus armer und niederer Familie, hatte späterhin ei-
nige Bildung erhalten und wusste sich in höheren Kreisen mit
solchem Anstand zu benehmen, dass ihr früherer Stand nicht
bemerkbar war. Katharina zeigte viele Bescheidenheit und Gut-
mütigkeit in ihrem Charakter, mischte sich nicht in Regierungs-
angelegenheiten und suchte nur dem Fürsten zu leben. Bereits
im Jahre 1781 versicherte der Fürst für seine mit ihr erzeugten
Kinder eine Summe von 70,000 Gulden auf der Rentkammer zu
Saarbrücken, wovon sie alljährlich die Zinsen mit 3500 Gulden
zu beziehen hatte und schenkte ihr in der Folge die Herrschaft
Dillingen, die zwar in der Revolutionszeit sequestiert, aber wie-
der zurückgegeben und von ihr verkauft wurde. Die Verhältnisse
ihrer sieben Kinder übergehen wir, da die Söhne ohne Nachkom-
men verstorben sind; sie führten den Titel: Herzöge von Dillingen
und Reichsgrafen von Ottweiler. Katharina selbst starb zu Mann-
heim am 11. Dezember 1829 in ihrem 72. Lebensjahr.“ [4]
Wie kam es zu dieser Heirat? Man kann heute nur darüber
spekulieren. Fürst Ludwig von Nassau-Saarbrücken gehörte
als Freimaurer der St. Heinrichs-Loge in Saarbrücken an und
muss daher als ein freisinniger Herrscher gegolten haben, bei
dem es kaum gesellschaftliche Schranken gegeben hat. Er ließ
sich in seiner Regierung weitgehend von dem Gedankengut der
Aufklärung bestimmen und gehörte noch weiteren Logen an. [5]
Vielleicht war es daher die einfache Art von Katharina, die ihn an
diese Person band. Sie war eben eine für damalige Verhältnisse
außergewöhnliche Frau.
Dadurch, dass Wilhelm Marzloff von Braubach, Patron zu Dillingen
und Wallerfangen, Rat des Herzogs von Lothringen, Präsident der
Assisen zu Wallerfangen und Gouverneur der Festung Wallerfangen,
seit 1591 auch als Grundherr von Roden gelten kann, ist das Schick-
sal mit der Burg in Dillingen eng verknüpft. So hat die alte Familien-
tradition überlebt, dass Vorfahren von mir im Dienst der Herzogin
standen und daher eine Parzelle des Anwesens auf dem Gelände
des alten Rodener Schlosses zu Wohnzwecken geschenkt bekamen,
wie Herzogin Katharina von Dillingen auch 1806 (1808) ihren Besitz
(1600 Morgen Wald und 400 Morgen Gärten, Äcker und Wiesen) an
die Dillinger Hütte zu Wohnzwecken verkaufte. [6]
Heute ergibt sich die Schwierigkeit, diese Schenkung nachzuweisen.
Einen Anhaltspunkt gäbe das Katasterwesen. Nach Recherchen im
Internet ergäbe sich für Frankreich in der fraglichen Periode folgende
Entwicklung:
„Auf Grund des Gesetzes vom 15. September 1807, welches der
Ursprung des französischen Parzellenkatasters ist, arbeitete eine
Kommission von neun Mitgliedern unter dem Vorsitz des Mathe-
matikers Delambre, ständigem Sekretär der Akademie der Wissen-
schaften, die Grundsätze aus, nach denen das Parzellenkataster
ausgeführt werden sollte und die zum Edikt vom 27. Januar 1808
führten. Dem Edikt, welches die Grundsätze genehmigte, folgte die
dazu gehörige Generalinstruktion vom 20. April 1808. Die zur Aus-
führung der Arbeiten ergangenen Gesetze, Verordnungen und In-
struktionen wurden vom Finanzminister im Jahre 1811 als „Receuil
méthodique des Lois, décrets, règlements, instrucrions et décisions
sur la Cadastre de la France; approuvé par le ministre des finances“
(Es war eine Umarbeitung der fünf Bände der „Collection des lois sur
le Cadastre de France“) herausgegeben, einem Werk, an dem zwölf
Generalinspektoren des Katasters mitwirkten, mit nicht weniger als
1’444 Artikeln auf rund 400 Seiten, aus dem einzelne Bestimmungen
wörtlich, andere verbessert in die Anweisung VIII vom 25. Oktober
1881 übernommen worden sind.
Nach dem Receuil méthodique wurden die Arbeiten bis zum Jahre
1813 fortgesetzt. Der Wert war unterschiedlich, am besten im Rhein-
und Moseldepartement und an der Saar.“ (nach Helmuth von Strombeck,
Hamburg)
So müssten erfolgversprechende Nachforschungen in Nancy, also in
der Hauptstadt der Region Lothringen, erfolgen.
Was die Bewirtschaftung ihrer Grundherrschaft angeht,
gingen einige Grundherren dazu über, diese an kapital-
kräftige Herren zu verpachten, die meist die großen
Flächen kommerziell ausbeuteten und dafür sehr hohe
Abgaben, 1/3 bis die Hälfte der Ernte, entrichteten.
Also kamen kleine Bauern als Pächter kaum in Frage.
[7] Während der Jahre der Französischen Revolution
verpachtete der Staat die unter Sequester stehenden
Grundherrschaften. [8]
ANMERKUNGEN
[1] Karl Lohmeyer, Die Sagen der Saar von ihren Quellen bis zur
Mündung, Minerva-Verlag Thinnes & Nolte, Nachdruck, Saarbrücken
1989, Seite 145.
[2] Geschichtliche Landeskunde des Saarlandes, Band 1, Minerva-
Verlag Thinnes & Nolte, Saarbrücken 1978, Seite 150.
[3] Geschichtliche Landeskunde des Saarlandes, Band 2, Selbst-
verlag des Historischen Vereins für die Saargegend e. V., Saar-
brücken 1977, Seite 313/14.
[4] Nachdruck der Ausgabe von 1865, Queißer Buchhandels- und
Verlagsgesellschaft, Dillingen 1979, Anhang: Seite 151.
[5] wie [2], Anmerkung zur Bildtafel „Abb. 42“. Freimaurer m.:
Angehöriger einer übernationalen Gemeinschaft mit humanitärer
Zielstellung (18. Jh.). Der in England gegründete Geheimbund
bedient sich der Symbole und Bräuche mittelalterlicher Bauhüt-
ten, aus denen sich der Name herleitet, engl. freemason, frz.
franc-macon… (Etymologisches Wörterbuch der Deutschen, EDITION
KRÄMER, Akademie Verlag GmbH, Berlin 2010, Seite 372)
[6] wie [2], jedoch die Seite 149/50.
[7] DER ADEL VOR DER REVOLUTION, Eberhard Weis, Der französische
Adel im 18. Jahrhundert, Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 1971,
Seite 36. „Albert Soboul … beziffert an Hand einer Anzahl neuerer
Einzelforschungen die Belastung durch die grundherrschaftlichen
Abgaben für die Bauern auf etwa 2 bis 20 % des Reinertrages der
Ernte, zu denen jedoch noch der Kirchenzehent, die Steuern und
die, allerdings meist niedrigen, Umlagen für die Gemeinde kamen.“
(Seite 40)
[8] Georg Baltzer, Historische Notizen über die Stadt Saarlouis
und deren unmittelbare Umgegend, Nachdruck der Ausgabe von 1865,
Queißer Buchhandels- und Verlagsgesellschaft, Dillingen 1979, An-
hang: Seite 152.
DER JÜDISCHE FRIEDHOF
AUTOR: Josef Theobald
Bevor wir näher in das Thema einsteigen, zunächst einmal eine
Abgrenzung zwischen Juden- und Christentum.
Die Christen glauben an die Unsterblichkeit der Seele und an das
Jüngste Gericht (Römer 14,9+10).
Die Juden dagegen glauben, dass der Leib verfault und auch von
Würmern verzehrt wird. Dennoch wird er vom Tode auferstehen
am Ende der Tage, um Teil zu haben am Heil der Endzeit (Daniel
12,13 – Prof. Karl Marti, KURZER HAND-COMMENTAR ZUM AT,
DAS BUCH DANIEL, Verlag von J. C. B. Mohr, TÜBINGEN und
LEIPZIG 1901, Seite 92).
Nach dem Vorbild des Patriarchen Abraham sicherte man sich
schon früh einen Erbbesitz, der für die in der Ferne Wohnenden
auch die eigentliche Heimat darstellte (Josua 24,30; 1. Mose o.
Genesis 23,4 u. Nehemia 2,3). Im Lauf der Jahrhunderte hatte
die Form der Gräber mehrfache Wandlungen durchgemacht. So
treffen wir zunächst auf die natürliche Höhle, schließlich auf die
aus dem Fels gehauene Grabkammer und dann auf das über der
Erde aufgebaute Steinhaus, weiterhin auf den aus einer Kammer
bestehende Felsraum und die mehrzimmerige, ja mehrstöckige
Grabwohnung, außerdem das Denkmal des Einzelnen (Dr. Paul
Volz, DIE BIBLISCHEN ALTERTÜMER, Nachdruck der Ausgabe
von 1914 bei fourier, Seiten 326/7).
Der Begräbnisplatz, seit der griechischen Epoche das „ewige Haus“
genannt, wird aber seit dem 5. und 6. Jahrhundert „Haus (Stätte) des
Lebens“ genannt, einem Ausdruck, dessen man sich namentlich seit
dem Ende des siebzehnten Jahrhundert wieder bediente (Dr. Leopold
Zunz, Zur Geschichte und Literatur, Berlin 1845, Nachdruck bei Georg
Olms Verlag, Hildesheim – New York 1976, Seiten 442/3).
Die einzelnen Grabsteine dienten ursprünglich als Markierung der als
unrein verstandenen Grabstätten und als Schutz des Leichnams vor
wilden Tieren, kamen dabei jedoch immer mehr der Aufgabe nach, die
Erinnerung an den Verstorbenen für die folgenden Zeiten zu bewahren.
Bis weit in die Neuzeit fand auch bei deutschen Juden die Bestattung
unmittelbar am Todestag statt, wenn der Tod nicht an einem Sabbat
eintrat. Allerdings machte die im 19. Jahrhundert ausgelöste und po-
pulär zu nennende Diskussion zum Thema „Begräbnis Scheintoter“
diesem Brauch ein Ende.
Etwa seit dem 10. Jahrhundert scheint in Europa bei den jüdischen
Gemeinden die Anlage von kommunalen Friedhöfen allgemein als
üblich zu gelten. Die hohe Bedeutung, die man einem solchen Ort
beimaß, lässt sich allein daran ablesen, dass man sich vielerorts
beim Entstehen einer jüdischen Gemeinde zuerst um die Anlage
eines Friedhofs kümmerte und erst dann um die Errichtung einer
eigenen Synagoge. So werden die jüdischen Friedhöfe traditionell
außerhalb der Ansiedlungen angelegt. Hierbei wird auf eine Grab-
pflege, die als verletzende Störung der Totenruhe verstanden wird,
und auch auf Grabschmuck, den man als heidnische Opfergabe an-
sehen konnte, bis ins 19. Jahrhundert generell und bei traditionellen
Juden bis auf den heutigen Tag verzichtet.
Gewöhnlich werden die Verstorbenen auf jüdischen Friedhöfen in
Grabreihen nebeneinander in der Abfolge ihres Sterbedatums be-
stattet. Der Abstand der Gräber voneinander beträgt üblicherweise
mindestens sechs Handbreit. Rabbiner und andere Gemeindemit-
glieder mit besonderer Stellung setzt man an besonderen Orten
bei. Auf vielen alten Judenfriedhöfen wurden Männer und Frauen
in getrennten Reihen begraben.
Der Aufbau und die Gestaltung der jüdischen Grabinschriften richten
sich nach einem festgelegten Formular:
1. Begräbnisformel;
2. Eulogie (Lobsprüche);
3a. Titulatur und Name;
3b. Name des Vaters (bzw. Gatten und dessen Wohnort);
4. Sterbe- und Begräbnisdatum;
5. Schlussformel.
Ein Beispiel für eine Eulogie wäre der Spruch: „Seine Seele werde
gebündelt im Bündel des ewigen Lebens.“
Figürliche Darstellungen wie Hirsch, Adler, Löwe usw. lassen eben-
falls auf den Namen schließen. Abbildungen von segnenden Händen
als Zeichen aaronidischer Herkunft, Krug und Kanne als Zeichen le-
vitischer Herkunft weisen auf die Abstammung des Verstorbenen hin.
Auch einzelne Berufe werden durch ihr Charakteristikum bezeichnet:
der Kantor durch ein aufgeschlagenes Buch, der Apotheker durch die
Gewürzmühle, der Schneider durch die Schere (W. Walter, MEINEN
BUND HABE ICH MIT DIR GESCHLOSSEN <Jüdische Religion in
Fest, Gebet und Brauch>, Kösel-Verlag, München 1989, Seite 166).
Ebenfalls von hoher Bedeutung sind die Namen und Daten auf den
jüdischen Grabsteinen. Da in jüdischen Gemeinden zumeist keine
„Kirchenbücher“ geführt wurden, sind die vorhandenen Inschriften
mit ihren Angaben über den Toten, seinen Vater oder Gatten sowie
dessen Wohnort oft die einzig gegebene Möglichkeit, für die Zeit vor
der Errichtung von Standesämtern mit Sterberegistern und Familien-
büchern genealogische Zusammenhänge zu rekonstruieren.
Gräber der Kohanim, also der Nachfahren der Priester im Tempel
von Jerusalem, findet man meistens nahe der Friedhofsmauer, so
dass Angehörige der Verstorbenen dessen Grab besuchen können,
ohne dabei den Friedhof betreten zu müssen. Dies ergibt sich aus
der verunreinigenden Wirkung dieses Ortes für Priester.
Allerdings fehlen auf den Grabsteinen in der Regel Altersangaben
und Geburtsdaten der Toten. Die angegebenen Daten richten sich
traditionell nach dem jüdischen religiösen Kalender.
Auf jüdischen Friedhöfen werden Verstorbene regelmäßig dadurch
ausgezeichnet, dass man auf ihren Grabsteinen kleine Steinchen
niederlegt. Der eigentliche Ursprung dieses doch volkstümlichen
jüdischen Brauches, in dem ein vorbeugender Abwehrzauber zum
Vorschein kommt, ist heute nicht mehr geläufig; er wird vielmehr als
Ausdruck der Verehrung verstanden (Michael Tilly, Das Judentum,
Matrix Verlag GmbH, Wiesbaden 2007, Seiten 170 – 173).
Auch gibt es die Sitte, Grasballen auf das Grab oder auf den Grab-
stein zu werfen. Mit dem Gras will man sich gegen böse Geister und
Gespenster schützen können (Alfred J. Kolatsch, JÜDISCHE WELT
VERSTEHEN, Fourier Verlag GmbH, Wiesbaden 1996, Seite 88).
Die Juden zeigen stets großen Respekt vor ihren Toten. So betreten
die Männer den jüdischen Friedhof nur mit einer Kippa („Der Sinn der
Kippa als regelmäßige Kopfbedeckung liegt in der Internalisierung des
Bewusstseins darüber, dass stets das Göttliche über einem steht.“ –
Quelle: Rabbiner Gino Eliezer Gross, SCHALOM <Im Jahreskreis des
jüdischen Lebens>, EDITION TAU, Bad Sauerbrunn <A> 1995, Seite
191) oder mit einem Hut. Diese Regel gilt auch für den Kreis der nicht-
jüdischen Besucher (Quelle: WIKIPEDIA; Stichwort: Jüdischer Fried-
hof).
Im Jahre 1754 verkaufte Charles Francois Dieudonné de Tailfumyr,
ein Jude, seinen Eisenhammer und die Schmelze in Dillingen und
Bettingen an Gustav Adolph Caranté und erlaubte 1755 den Juden
Hayem und Zerf Worms und Elias Reutlinger von Saarlouis, gegen
einen jährlichen Zins von 24 lothringischen Francs, die an jedem St.
Georgentag zahlbar waren, im Dillinger Walde einen Judenkirchhof
zu gründen (Georg Baltzer, Historische Notizen über die Stadt Saar-
louis und deren unmittelbare Umgebung, Nachdruck der Ausgabe
von 1865, Queißer Buchhandels- und Verlagsgesellschaft, Dillingen
1979, Seiten 148/9).
Begleitliteratur
Dr. Salomon Ludwig Steinheim, Die Offenbarung nach dem Lehr-
begriff der Synagoge, 4 Bände, Altona 1865, Nachdruck bei Georg
Olms Verlag, Hildesheim – Zürich – New York 1986, hier besonders
der 4. Teil, die Zweite Abteilung, hiervon die Seiten 425 + 428.
DIE TRADITION DES STROHSTUHLFLECHTENS IN RODEN
AUTOR: Josef Theobald
Erstmals berichtete der Heimatforscher Erich Hewer aus
Roden über das Handwerk des Strohstuhlflechtens, das
dort überwiegend in der Winterstraße, Neu- und Altstraße
und ebenfalls in der Mühlenstraße ausgeübt wurde. Dies
war vorwiegend die Arbeit von Frauen. Freitags wurden
die fertigen Stühle dann abgeliefert. Dies war auch der
Zahltag, an dem ein Mann mit einem Karren erschien,
um die Stühle mit einer fertig geflochtenen Sitzfläche
abzuholen.
Die fleißigen Strohstuhlflechterinnen erhielten als Roh-
produkt gebeizte Stühle, Die Lackierung erfolgte erst
nach dem fertigen Flechten der Sitze. Vor 1925 wurde
das Flechten der Stuhlsitze in Heimarbeit für die Stuhl-
fabrik in Fraulautern betrieben. Doch mit den auf einmal
in Mode kommenden Buchenholzstühlen mit den hoch-
gepressten glatten oder mit Ornamenten versehenen
Sitzen starb diese alte Tradition aus. Die Kundschaft
favorisierte plötzlich stabile Sitzflächen, auf die man
weiche Kissen legen konnte. [1]
Wie war aber dieser Produktionszweig organisiert?
Neben der selbständigen Handwerksarbeit, die sich
in der Manufakturproduktion weiter fortsetzte, gab
es schon erste Ansätze einer Steigerung durch die
maschinelle Industrie. Als Vorbild für eine parallele
Sonderform galt hier das Verlagssystem. wie in den
anderen Regionen Deutschlands (die Handels- und
Gewerbezentren Sachsens, des Rheinlandes oder
der Augsburger Gegend). Die Verleger selbst kamen
entweder aus den Reihen ehemaliger Kaufleute oder
waren Teil wohlhabender Kaufmannsfamilien mit der
Tradition im Groß- und Fernhandel. Nebenbei mischten
auch ehemalige Handwerker und manchmal auch die
Mitglieder der Beamtenbürokratie mit. Diese waren im
Vertrieb relativ homogener Güter, wie Tuche, Bänder,
Uhren, Nadeln, Messer usw. tätig. Für dieses Produk-
tionssystem typisch war hier das Fehlen des bei einem
Großbetrieb vorhandenen großen Fixkapitals. Jenes be-
schriebene System verwandelte allerdings selbständige
Handwerker in häufig scharf ausgebeutete Teilarbeiter.
Denn durch fortschreitende Teilung der Arbeit erhöhte
sich auch die Produktivität. Die Werkzeuge und eben-
so das nötige Arbeitsmaterial stellten die Verleger. Die
dabei eingesetzten Werkzeuge wurden infolge ständiger
Produktionskontrollen in den Häusern der Heimarbeiter
einer kontinuierlichen Verbesserung unterworfen. [2]
Die Heimarbeit oder die Hausindustrie sind Überreste des
Übergangs der bäuerlichen Wirtschaft zur Manufaktur. Vor
allem der Zeitraum zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert
brachte eine weite Verbreitung der ländlichen oder Proto-
Industrie. In dieser Epoche ist z. B. die Textilarbeit zu einer
zusätzlichen Einkommensquelle für bäuerliche Familien ge-
worden. Gewöhnlich lag die zentrale Werkstatt des Handels-
unternehmers in der Stadt oder nicht weit entfernt davon und
bildete dort die kommerzielle Basis des gesamten Heimarbeits-
systems, das weit über das Land verstreut war.
Oft gab es ein Interesse, eine ländliche Hausindustrie in den
Gebieten zu organisieren, wo die Landwirtschaft ärmlich war,
wie etwa in den Berggegenden (z. B. Eifel). Infolge der Erb-
teilungen besaß die ländliche Bevölkerung sehr wenig oder
gar kein Land und musste deshalb Möglichkeiten suchen,
ihr Einkommen aufzubessern oder sich dem Heimgewerbe
zuzuwenden. Ein anderer Faktor war die hohe Bevölkerungs-
dichte, somit die Zahl der Arbeitskräfte relativ groß war und
die Löhne entsprechend niedrig.
Der Niedergang der Arbeitsproduktivität und des landwirt-
schaftlichen Pro-Kopf-Einkommens war der Hauptgrund
für die Suche der bäuerlichen Familien nach alternativen
Tätigkeiten. Diese Formen ländlicher Hausindustrie waren
in einigen Gebieten weiter verbreitet als in anderen. Diese
Gebiete mit ländlichem Gewerbe waren in den folgenden
deutschen Regionen zu finden: im Rheinland, in Westfalen,
in Sachsen und in Schlesien sowie im Osten Polens und in
Russland. [3]
Im Russland des 19. Jahrhunderts gab es eine Produktion
von Holzlöffeln in Heimarbeit. So gab es Dörfer, die auf das
Abdrechseln oder auf das Lackieren der Löffel spezialisiert
waren. Bei diesen Produktionsverhältnissen konnte man nur
das unbedingt Notwendige verdienen. Durch die gegebenen
Arbeitsbedingungen war eine Trennung von Wohn- und Ar-
beitsraum fast unmöglich. So kam es in den Wohnungen zu
sanitären Missständen mit der Folge, dass nicht selten Berufs-
krankheiten auftraten. Weiterhin waren Formen von Kinderar-
beit ab dem 5. Lebensjahr zu beobachten. In der Arbeitspraxis
bediente man sich den Mittelspersonen, die zum Teil in einer
hierarchischen Stufe das zu bearbeitende Material en gros ü-
bernahmen und dann im Kleinen vergaben. [4] Auch im ost-
europäischen Russland war die Hausarbeit Anhängsel der
Fabrik. In der täglichen Arbeitspraxis bedeutete dies eine
stärkere Konzentration der Produktion und des Kapitals
sowie eine entwickeltere Arbeitsteilung und stellte folglich
dem Entwicklungsgrad nach eine wesentlich höhere Form
des Kapitalismus dar. [5]
Strohstühle, waren (2) Stühle, deren Sitz aus einem Rahmen
und darüber geflochtenem Stroh bestand. [Pierer’s Universal-
Lexikon (1857-1865), Stichwort: Strohstühle, Bd. 16, S. 933]
Berufe, wie das Tischlerhandwerk, profitierten vor allem in der
Gründerzeit, und zwar in den Jahren nach dem Deutsch-Fran-
zösischen Krieg (1870/71), von der gegebenen Situation, dass
vor Ort keine überlegene Industriekonkurrenz vorhanden war.
Hinzu kamen das Bevölkerungswachstum und der Bauboom
in den betreffenden Jahren. [6]
Wir wissen heute allerdings, dass nur wenige ländliche Unter-
nehmer die eigentliche Industrialisierung finanzierten (diese
kamen meistens aus der Stadt); die Arbeitskräfte vom Land
gingen nur selten zur Arbeit in die Fabriken, das Heiratsalter
war in der Proto-Industrie nicht anders als in der traditionellen
landwirtschaftlichen Welt, und es fehlte hier außerdem eine
enge Verbindung zwischen der Proto-Industrie und dem Be-
völkerungswachstum. Es war aber nicht ungewöhnlich, dass
die Familien in Gebieten mit traditioneller Landwirtschaft doch
schneller wuchsen als dort, wo es lediglich eine Proto-Industrie
gab. [7]
In der Zeit der Massenarbeitslosigkeit nach dem I. Weltkrieg
verlagerte sich die Produktion von Strohstühlen nach Frank-
reich, Dort verwendete man zum Flechten das Peddigrohr,
eine Rohrart, die man aus Spanien importierte. Die Kosten
für die Beschaffung dieses Arbeitsmaterials wurden aber
vom Arbeitslohn der Strohstuhlflechter einbehalten. Da-
durch waren die Produktionsbedingungen in Frankreich
günstiger und das neu eingesetzte Peddigrohr entsprach
der damaligen Mode.
ANMERKUNG
[1] Geschichte der Kreisstadt Saarlouis, Band 6: Roden,
Autor: Marc Finkenberg, Herausgeber: Kreisstadt Saarlouis
(1997), Seiten 157 + 158.
[2] Jürgen Kocka, Unternehmer in der deutschen Industrial-
isierung, Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 1975, Seiten
20 – 22.
[3] Paolo Malanima, Europäische Wirtschaftsgeschichte (10.-19.
Jahrhundert), Böhlau Verlag, Wien 2010, Seiten 248, 281/2.
[4] W. I. Lenin, Werke, Band 3: Die Entwicklung des Kapitalis-
mus in Russland, Dietz Verlag, Berlin-Ost 1956, Seiten 395, 408
+ 452/3.
[5] W. I. Lenin, Werke, Band 2, Dietz Verlag, Berlin-Ost 1961,
die Seite 368.
[6] Österreichische Geschichte, ÖKONOMIE UND POLITK, Autor:
Roman Sandgruber, erschienen im Verlag Carl Ueberrreuter,
Wien 1995, Seite 256.
[7] wie [3], jedoch die Seite 283.
DAS GEWERBE DER LEINEWEBER
AUTOR: Josef Theobald
Leinenweber verarbeiteten ursprünglich sowohl den gesponnenen Flachs
als auch Hanf zu Leinwand; seit etwa 1500 wurde Hanf hauptsächlich nur
noch für Haustuch, Sack- und Packleinwand, grobe Zeuge wie Segeltuch
und Seilwaren verwendet. Im Gegensatz zur Tuchmacherei (Wollweberei),
die sich doch meist als städtisches Handwerk etablierte, war dagegen die
Leinenweberei lange Zeit im ländlichen Raum als Heimgewerbe verbreitet
und wurde vielfach von hörigen Bauern und Tagelöhnern betrieben. Leinen-
weber war im Mittelalter ein hochgeschätztes Gewebe, aus dem nicht nur
Hemden und Bettzeug, sondern auch Kleider, Waffenröcke, Satteldecken,
Hutbezüge und Paniere verfertigt wurden. [1]
Das Gewerbe der Leinenweberei war ursprünglich ein Nebengewerbe der
Landwirtschaft. Doch mit der steigenden Mannigfaltigkeit und Kunstfertig-
keit der Produktion konnte das bisher betriebene Nebengewerbe nicht
mehr von denselben oder einzelnen Personen ausgeübt werden. So
sonderte sich das Handwerk vom Ackerbau. Mit der Spaltung der Pro-
duktion in zwei große Hauptzweige, Ackerbau und Handwerk, entsteht
die Produktion direkt für den Austausch, die Warenproduktion; mit ihr
der Handel, nicht nur im Innern und an den Stammesgrenzen, sondern
auch schon über See. [2]
Im 18. Jahrhundert nahm das Landhandwerk allgemein zu. Grund dafür
war in erster Linie die Notwendigkeit der Beschäftigung einer wachsen-
den Zahl von Menschen zwecks Bestreitung ihres Unterhalts durch den
Nebenerwerb oder den Übergang zu heimgewerblicher Produktion. Das
Einkommensniveau blieb aber nach wie vor gering. [3]
Die Voraussetzung für die Leineweberei ist der Flachsanbau. Hier bleibt
der größte Teil der Einkünfte entweder bei den Aufkäufern oder bei den
Verpächtern von Boden hängen. Die größeren Flachsaufkäufer richteten
Trockenräume und Pressen ein; sie dingten Arbeiter zum Sortieren und
Schwingen des Flachses. Dabei muss angeführt werden, dass die Bear-
beitung des Flachses besonders viel Arbeitskräfte erforderte. Dies führte
schließlich dazu, dass der Landwirt in der Winterzeit mehr beschäftigt war,
andererseits schaffte dies eine Nachfrage nach Lohnarbeit auf der Seite
der Gutsbesitzer und wohlhabenden Bauern, die Flachs anbauten. [4]
Typisch für den Vertrieb war hier das Verlagssystem. Dabei traten Kauf-
leute mit kleinen gewerblichen Produzenten in Verbindung. Somit blieb
die Produktion dezentral. Der Absatz der erzeugten Produkte sowie de-
ren Weiterverarbeitung ist zentral erfolgt. Zentral beschafft wurde auch
das Rohmaterial. Diese Entwicklung ergab sich aus der Notwendigkeit,
wachsende und entfernte Märkte zu versorgen.
Die Arbeitstechnik der Leineweberei wurde meist von den Eltern auf ihre
Kinder weitergegeben. Denn im Arbeitsprozess war Kinderarbeit Alltag.
Dadurch wurde eine Steigerung der Produktion erreicht. Diese Arbeits-
weise nennt man auch „proto-industrielle“ Familienwirtschaft, die in den
Zeiten schlechter Preise und geringen Absatzes gezwungenermaßen
und selbstverständlich zur Selbstausbeutung überging. Diese kleinen
gewerblichen Produzenten lebten in Häuslerhäusern auf bäuerlichem
Grund, zum Teil abgesetzt vom Dorf in eigenen Häusern (Hüttchen).
Wohnten sie in den Dörfern, gehörten sie allerdings nicht zur Dorf-
gemeinde. War die Produktion verlagsmäßig organisiert und wurden
vom Verleger Werkzeug und Rohstoffe gestellt, so näherte sich der
Status eines Heimarbeiters dem des lohnabhängigen Manufakturar-
beiters. In der Praxis ist es aber auch vorgekommen, dass ein ge-
werblicher Kleinproduzent doch zu bescheidenem Wohlstand und
zu der Stellung eines Zwischenmeisters im Verlagssystem gekom-
men ist. Zu einem Verleger selbst ist er oft kaum aufgestiegen.
In stadtfernen Gebieten, wo sich dieses Gewerbe verdichtete, hat
diese Bevölkerungsgruppe offensichtlich ein Eigenleben geführt.
Denn man heiratete vorwiegend untereinander und gründete je-
weils wieder eine Spinner- und Weberfamilie. [5]
Wie das Beispiel der oberösterreichischen Leinenindustrie zeigt, kon-
nte dieser Zweig an der inländischen Textilkonjunktur des späten 18.
Jahrhundert teilhaben, was durch die Freigabe der Leinenweberei auf
dem Lande 1755/73 begünstigt wurde. Der Aufschwung brach aber um
etwa 1800 auf einmal ab, wohl im Zusammenhang mit der plötzlich über-
mächtig gewordenen Konkurrenz der Baumwollindustrie, der die Leinen-
industrie wenig entgegenzusetzen hatte. Ebenfalls gingen während der
napoleonischen Zeit der Überseemarkt und das Westgeschäft zur Gänze
verloren. Leinen, einstmals das wichtigste nicht-landwirtschaftliche Export-
gut der Habsburgermonarchie, wurde im frühen 19. Jahrhundert fast nur
mehr für das Inland erzeugt, wenn es überhaupt auf den Markt kam. [6]
Schon Friedrich Engels wies in seinem Vorwort zur zweiten Auflage der
Schrift „Zur Wohnungsfrage“ darauf hin, dass die Leinenweberei zu der
Zeit, als sie für den Weltmarkt arbeitete, schon soweit durch die Steuern
und Feudallasten erdrückt wurde, dass sie den webenden Bauer nicht
über das sehr niedrige Niveau der übrigen Bauernschaft erhob. [7]
NACHTRAG
In Saarlouis-Roden haben wir eine Leineweberstraße zwischen der
Lindenstraße und der Ellbachstraße. So deutet heute alles darauf
hin, dass sich ursprünglich diese Straße in früheren Jahrhunderten
außerhalb der eigentlichen Besiedlung befand. Nach dem II. Welt-
krieg waren die hier befindlichen Häuser meist vollständig zerstört
und wurden schließlich in den Fünfziger Jahren im Stil der Wieder-
aufbaujahre neu errichtet. Das Haus mit der Nr. 7 hatte fast noch
den alten Stil der Häuslerhäuser. Nach einem erfolgten Umbau ist
der alte Baustil heute leider nur noch zu erahnen.
ANMERKUNGEN
[1] Quelle: WIKIPEDIA, Stichwort: Leinenweberei.
[2] Marx – Engels, Ausgewählte Werke in zwei Bänden,
Band II, Dietz Verlag, Berlin-Ost 1966, Seite 287.
[3] Rudolf Vierhaus, Deutschland im Zeitalter des
Absolutismus (Deutsche Geschichte 6), 2. ergänzte
Auflage, Kleine Vandenhoeck-Reihe, Göttingen 1984,
Seite 38.
[4] W. I. Lenin, Werke, Band 3: Die Entwicklung des
Kapitalismus in Russland, Dietz Verlag, Berlin-Ost
1956, Seiten 286/87.
[5] wie [3], jedoch die Seiten 39/40 und 69/70.
[6] Österreichische Geschichte, ÖKONOMIE UND POLITIK,
Autor: Roman Sandgruber, Verlag Ueberreuter, Wien 1995,
Seite 184.
[7] Marx – Engels, Ausgewählte Schriften in zwei Bänden,
Band I, Dietz Verlag, Berlin-Ost 1966, die Seite 521.
DIE RODENER MÜHLEN
AUTOR: Josef Theobald
Wie bei anderen Bachläufen in unserem Einzugsgebiet, wurde
auch der „Ellbach“ von den Anwohnern auf sehr vielfältige Art
und Weise genutzt. Dabei dominierte nicht die private, sondern
vor allem die wirtschaftliche Nutzung im regionalen Manufaktur-
wesen. Denn Wasser bedeutete und bedeutet immer auch Was-
serkraft und die Nutzung selbiger Wasserkraft, zur damaligen Zeit,
in Form von Mühlen. Denn durch sie konnten schwerste Arbeiten
wesentlich vereinfacht werden und, bezogen auf die reinen Pro-
duktionsziffern, eine weit größere Menge als bisher hergestellt
werden. Dabei kann man aufgrund der verschiedenen Mühltypen
den „Ellbach“ als einen historischen Indikator nutzen, der anzeigt,
welche wirtschaftlichen Faktoren einmal aufkamen, zum anderen
aber wann und wie sie zusammenhängen. Dominierten anfangs
die Getreidemühlen das Bild am „Ellbach“, ein deutlicher Hinweis
auf die eher agrarisch ausgerichtete Bevölkerung und dem primä-
ren Einkommensbereich der Mehlproduktion, so kamen seit 1734
neue Mühlen hinzu. Durch die französische Vorreiterrolle bei der
Lohgerbertechnik benötigten die Gerber natürlich noch eine Loh-
mühle, in der Eichenrinde und Lohepulver (ein Extrakt aus gerb-
stoffreichen Rinden, Blättern oder Holz von Eichen und Fichten)
gemahlen wurden. Und natürlich auch Holz. Letzteres wurde in
der Sägemühle geschnitten, ersteres in der Lohmühle hergestellt.
Doch mit der Lohgerberei und einem offensichtlichen Bedarf an
Gerber- und Kürschnerwaren blieb es natürlich nicht aus, dass
man sich ganz im Sinne des Manufakturwesens darum bemühte,
auch andere Produktionsvorgänge zu vereinfachen. Eine typische
und sicherlich nicht regional spezifische Entwicklung war die Saar-
Mühle, die anfangs als Walkmühle genutzt wurde. Auch die Ver-
schiebung der Primärproduktion des Gerbereiwesens von Frank-
reich weg in andere europäische Staaten, bis hin zu dem anglo-
amerikanischen Wirtschaftskrieg im Bereich der Schnellgerberei,
kann man an den Mühlen und damit indirekt am Mühlenbach er-
kennen. Ein geradezu ideales Beispiel stellt auch hier wieder die
Saar-Mühle dar. Einst als Walkmühle gegründet, vollzog sie den
Wandel zur Mehlmühle. Man kann also recht einfach schlussfol-
gern, dass hier keine technischen Defekte, fehlende Investitionen
oder eine Unterbrechung der Müllerlinie zum Wandel führten. Denn
dann hätte man sie einfach geschlossen. Sondern einfach der feh-
lende Bedarf, der einfach einen weiteren Betrieb im alten Stil für un-
sinnig und unrentabel erschienen ließ.
Spätestens seit 1800 war ein Ende der Mühlen eigentlich absehbar
und eng an das Schicksal der Gerber und Kürschner gekoppelt. Je
weniger denn deren Geschäft lief, desto weniger Lohe benötigten
diese, desto weniger wurde gewalkt, desto weniger Holz und Lohe
wurden verbraucht, desto weniger benötigte man also die Mühlen.
Doch was blieb den Betreibern für eine Alternative? Natürlich Mehl
mahlen, denn Bauern gab es ja weiterhin. Doch war das wirklich ei-
ne Alternative und wenn „Nein“ warum? Der Fortschritt bedingt auch
heute noch ein Zusammenrücken unserer Welt. Wir nennen es heu-
te einfach Globalisierung und oft wird dieser Begriff in einem Zug mit
einem „Schrecken der Globalisierung“ in Zusammenhang gebracht.
Damals bedeutete es schlicht, dass Saarwellingen und Roden sehr
nahe beieinanderlagen und durch den technischen Fortschritt noch
ein wenig näher rückten. Und der „Ellbach“ ist ein nun mal ein Bach
und kein Strom, der sich über hunderte von Kilometern hinzieht. Neun
Mühlen, mit gleicher Ausrichtung, auf so engem Raum bedeuteten ei-
ne fast unerträgliche Konkurrenzsituation. Und doch hätte es vielleicht
gut gehen können. Doch bescherte der Fortschritt noch ein weiteres
Problem. Die Verlagerung des bedeutendsten Wirtschaftsfaktors, weg
von der Agrarwirtschaft, hin zur Kohle- und Metallindustrie. Und dort
braucht man sicher auch Wasser, z. B. zur Kühlung, aber sicherlich
keine Mühlen. Ein typischer Rodener Bauer war zudem nie nur allein
ein Bauer. Er war Bauer und Bergmann oder, was wesentlich häufiger
vorkam, Bauer und Hüttenarbeiter. Dieser Ausdruck bezieht sich vor
allem auf die nah gelegene Dillinger Hütte. Doch wer nur noch in der
Zweitfunktion Bauer ist, baut lange nicht mehr so viel an, wie ein jener
Bauer, der dieser Tätigkeit ausschließlich nachgeht. Und so wurde es
immer stiller um die Mühlen, bis man zum Schluss neun defizitäre und
teils hoch verschuldete Betriebe zählte, die daher so nicht überlebens-
fähig gewesen wären. Die Lösung war recht einfach und schnell gefun-
den: Abfindungen und Schließungen. Denn die ansonsten so beliebte
Lösung im Agrarbereich, Subventionen zu gewähren, würde lediglich
ein bodenloses Loch aufreißen. Das war allen Beteiligten bewusst. So
gibt es in letzter Zeit andererseits die eine oder andere Initiative, zumin-
destens die Bausubstanz der Abels-Mühle zu bewahren, wobei man nun
aber heute vielleicht eher von den historischen Resten der Abels-Mühle
sprechen sollte, die noch in Form eines Silos bestehen. Inwieweit diese
Bemühungen aber Früchte tragen werden, bleibt abzuwarten.
Man unterscheidet folgende Mühlen:
– die Getreidemühlen (z. B. Abels-Mühle, Kreuz-Mühle, Quirinsmühle,
Schillesmühle, Saar-Mühle, Pittenmühle und Reqniersmühle),
– die Sägemühlen (z. B. Sägemühle an der Ortsgrenze zur Gemeinde
Saarwellingen),
– die Gerbereimühlen (z. B. Lohmühle, Saar-Mühle als Walkmühle). [1]
Die älteste urkundlich erwähnte Getreidemühle ist die Kirchen- oder
Abels-Mühle. In einer Urkunde vom Jahre 1593 gab die Abtei Tholey
die Kirchenmühle in Erbpacht an den damaligen Grundherrn von Ro-
den mit Namen Laudwein Bockenheimer. Diese Mühle wurde 1989
durch einen Brand vollkommen zerstört.
Die Schillesmühle wurde im Jahre 1767 erstmals urkundlich erwähnt.
Ihren Namen hatte sie von dem ehemaligen Besitzer Jakob Schille,
der das Bannmühlenrecht im Jahre 1769 ersteigert hatte. In preus-
sicher Zeit arbeitete sie hauptsächlich für das Proviantamt. Trotz
einer Modernisierung während des II. Weltkrieges wurde sie bei
Kriegsende zerstört und nicht wieder aufgebaut.
Die erste Lohmühle in Roden wurde bereits im Jahre 1618 ur-
kundlich erwähnt, die von dem damaligen Grundherrn Wilhelm
Marzloff von Braubach verpachtet wurde. Wahrscheinlich hat
diese Lohmühle für die Wallerfanger Gerberindustrie gearbeitet.
Später wurde aus dieser Mühle eine Ziegelei, die im II. Weltkrieg
zerstört wurde.
Eine zweite Loh- oder Gerbmühle wurde im Jahre 1685 am Unter-
lauf des Ellbachs errichtet. Wahrscheinlich sollte diese den wohl
gesteigerten Bedarf an Lohe decken. Auch aus dieser Lohmühle
wurde im Jahre 1886 eine Ziegelei, die schließlich im Jahre 1976,
zehn Jahre nach ihrer Schließung, abgerissen wurde.
Auch die Saar-Mühle stammt wahrscheinlich aus der Mitte des
18. Jahrhunderts. Sie stand an der Mündung des Ellbachs in die
Saar. Im Jahre 1872 wurde sie umgebaut und modernisiert. Sie
brannte im Dezember 1927 ab und wurde nicht wieder aufgebaut.
[2]
ANMERKUNGEN
[1] Andreas Neumann, RODENA -Rodener Geschichte(n) 2008-,
2. Auflage 2009, erschienen im Eigenverlag von A. Neumann
(Fa. CSW, Wadgassen), erstes Buch in der Reihe der Titel des
RODENA Heimatkundevereines Roden e. V., Seiten 22 + 23.
[2] GESCHICHTE DER KREISSTADT SAARLOUIS, Band 6: Roden
(Traditionsbewusstes Dorf und moderner Stadtteil), Autor: Marc
Finkenberg, Herausgeber: Kreisstadt Saarlouis (1997), Seiten
81 + 82.
DER AUSDRUCK „OBERHÖLLEN“
AUTOR: Josef Theobald
Der Begriff „Hölle“ kommt vom Althochdeutschen „hella“ und war als
diese Schreibweise im 9. Jahrhundert üblich. Über den Weg des Mit-
telhochdeutschen bzw. Mittelniederdeutschen wurde aus dem Termi-
nus „helle“ das heutige „Hölle“. Letzterer Ausdruck war allgemein seit
dem 17. Jahrhundert durch die Übernahme aus dem Niederhochdeut-
schen gebräuchlich.
Ursprünglich bezeichnet „Hölle“ „das Verbergende oder Verborgene“
und zielt schließlich auf den unterirdischen Aufenthalt der Toten. [1]
Der Ausdruck „Hölle“ entspricht dem griechischen „Hades“ (auch Aides,
Aidoneus), Dieser war der finstere König der Unterwelt, der bei der Ver-
teilung der Welt das modrige Schattenreich erhielt und unerbittlich und
mitleidlos über die Toten waltete. Da er den Toten keine Rückkehr aus
seinem Reich gestattete, war er bei den Menschen gefürchtet und ge-
hasst. Im späteren Altertum verstand man unter „Hades“ auch dessen
Reich, die Unterwelt selbst. [2]
Das hebräische Gegenstück „Scheol“ kann „Grab, Tod, unersättliches
Monster, Unterwelt und das Reich der Toten“ bedeuten.
Infolge der mittelalterlichen Mystik gewann der Begriff „Hölle“ eine an-
dere Bedeutung, nämlich im Sinne des „Höllenfeuers“ (griechisch „ge-
henna“) als Ableitung vom Hebräischen „gai-hinnom“, das in Deutsch
Tal „Hinnom“ bedeutet. In späterer Zeit war es ein Ort, an welchem
Abfälle und Kadaver verbrannt wurden. Mit „Gehenna“ wurden von
daher zwei Gedanken assoziiert: das Leiden der Geopferten sowie
Schmutz und Korruption. In der prophetischen Tradition gilt deshalb
„Gehenna“ als der Ort des Gerichts Gottes (Jer. 19,6ff). [3]
Abweichend dazu stellt der jüdische Mediziner und Religionsphilosoph
Salomon Ludwig Steinheim (1789-1866) fest, dass „Scheol“ „das For-
dern, das Leere, was zu verschlingen strebt, also die Höhle“ bezeich-
net. Damit widerspricht er der gängigen christlichen Theologie, indem
er hier „eine Behausung der bösen Geister“ verneint. Hinzu zählt er
auch die christliche Lehre von der „alles verschlingenden Wohnung
der Schrecken, der Qualen, des ewigen Feuers“. Auch könne man
„Scheol“ mit „Gruft“ übersetzen. Schließlich leitet er „Gehenna“ vom
hebräischen „Tophet“ ab, das von der Wurzel „Tuph“ abgeleitet ent-
sprechend „Dörren, Verbrennen“ bedeutet (vergl. Jeremia 34,2) und
somit mit „Brenntal“ zu übersetzen wäre. [4]
Damit wäre nun geklärt, dass mit den „Oberhöllen“ nur die „oberen
Gräber“ oder ein „Gräberfeld“ aus der Historie Rodens gemeint sein
können. Gehen wir jetzt vom Standort des alten Friedhofs auf dem
früheren Gelände der Gärtnerei der Geschwister Comtesse aus, so
ergibt sich eben diese Blickrichtung. Wie schon einmal angesprochen,
kann dies lediglich ein frühes Gräberfeld von Kelten sein. Dies war von
Anfang an der Standpunkt des RODENA Heimatkundevereins Roden
e. V. Denn bei den Römern dominierte meist die Bestattung durch die
Verbrennung und durch eine Beisetzung der Asche im Grab oder Co-
lumbarium, daneben gab es vereinzelt Sarkophag-Bestattungen, die
vor allem seit dem 2. Jahrhundert u. Z. überhand nehmen, hierdurch
die stattliche Zahl der Sarkophag-Plastiken der mittleren bis späteren
Kaiserzeit. [5] Auch bietet sich an dieser Stelle der Ort „Pachten“, das
römische „Contiomagus“, an.
ANMERKUNGEN
[1] Etymologisches Wörterbuch der Deutschen, EDITION KRAMER,
Akademie Verlag, Berlin 2010, Seite 552.
[2] LEXIKON DER ANTIKE, Anaconda Verlag, Köln 2010, Seite 223.
[3] MÜNCHENER THEOLOGISCHES WÖRTERBUCH ZUM NEUEN TESTAMENT,
Patmos Verlag, Düsseldorf 1997, Seiten 206 – 208.
[4] Die Offenbarung nach dem Lehrbegriff der Synagoge, der
Teil 4, im Nachdruck des Georg Olms Verlages, Hildesheim usw.
1986, die Seiten 473/74.
[5] wie [2], jedoch die Seite 92.
DER STEPHANUSTAG
AUTOR: Josef Theobald
Traditionell am 2. Weihnachtstag wird dem hl. Stephanus gedacht, der
in kirchlichen Kreisen als der erste christliche Märtyrer gilt.
Die Apostelgeschichte behandelt in seinem 6. Kapitel die hellenistische
Gemeinde, der sieben Diakone zugeteilt wurden. Die hier wohl heraus-
ragende Person war die des Stephanus (aus dem Griechischen „der mit
einem <Sieges->Kranz Geschmückte“).
Die Hellenisten waren gegen das jüdische Gesetz und gegen die Sitten
des Judentums. Als sogenannte „Griechlinge“ arbeiteten sie ingrimmig
gegen das Gesetz der Väter und gegen die altväterlichen Sitten. Ihre
Bestrebungen gingen dahin, das väterliche Gesetz ganz und gar abzu-
schaffen im Sinne einer Hellenisierung des jüdischen Volkes. [1] Damit
standen sie im Gegensatz zu den frommen Aßidäern (Chassidim).
In Apostelgeschichte 7,48 wendet sich Stephanus gegen den Jerusalemer
Tempel selbst, indem er ihn als etwas Handgemachtes bezeichnete. Dies
war sein Todesurteil. Der damals junge Saulus wurde vom Sanhedrin be-
auftragt, die Hinrichtung zu vollstrecken und auch den Rest der Gemeinde
durch eine große Verfolgung zu vernichten (8,1-3).
Im deutschsprachigen Raum ist die Meinung von Martin Dibelius (1883-1947)
vorherrschend, dass die in die Apostelgeschichte aufgenommene Rede nicht
zum ursprünglichen Bestand der Stephanusgeschichte gehöre, sondern vom
Verfasser der Apostelgeschichte her an dieser Stelle zu begreifen sei. [2]
Fest steht aber, dass die christliche Urgemeinde erstmals negativ durch das
Wirken der Hellenisten aufgefallen ist. Daher ist auf der Seite des jüdischen
Sanhedrin angenommen worden, hier handele sich um eine neue Richtung
im Judentum, die gegen den Tempel und das jüdische Gesetz auftrete.
Deshalb die im 9. Kapitel der Apostelgeschichte geschilderte anfängliche
Haltung des Saulus gegenüber der christlichen Gemeinde in Damaskus.
Mit Morddrohungen verfolgte er die dortige Gemeinde des „Weges“ (die
Verse 1 + 2). Hier ist wohl an eine besondere Richtung im Judentum zu
denken, die sich an der früheren Anawim-Bewegung orientierte. Saulus
war damals der Ursprung dieser Gemeinde völlig unbekannt, der höchst
wahrscheinlich im Jerusalemer Tempel zu suchen ist (6,7).
Der Bericht über den Stephanus soll die Botschaft vom Bruch des späteren
Christentums mit dem Judentum und dem Tempel vorbereitend überbringen.
Die historische Wahrheit hinter dieser Darstellung der Apostelgeschichte war
vermutlich der provokative Wutausbruch eines führenden Mitglieds der ersten
Christengemeinde, der dazu geführt hatte, dass sich plötzlich in jenen Tagen
die so leicht erregbare Menge in Jerusalem auf diesen Mann stürzte und ihn
lynchte. [3]
In der apokryphen Literatur des Neuen Testaments gibt es bezüglich des
Saulus (Paulus), dem eigentlichen Begründer des heutigen Christentums,
eine starke Kontroverse. Vor allem jüdischen Rabbinern ist die in seinen
Briefen festgehaltene Theologie äußerst suspekt, da er vor allem Jesus
Christus in den Mittelpunkt seiner Mission stellt und schließlich durch die
Herausstellung dessen Todes eine andere Lehre begründet, die in einen
Gegensatz zur bisher überlieferten jüdischen Anschauung zu bringen ist.
ANMERKUNGEN
[1] Heinrich Graetz, Volkstümliche Geschichte der Juden in
zwei Bänden, Parkland Verlag, Köln 2000, die Seite 339.
[2] Bonner Biblische Beiträge, DAS HEILSGESCHICHTLICHE CREDO
IN DEN REDEN DER APOSTELGESCHICHTE, Verfasser: Klaus Kliesch,
Peter Hanstein Verlag, Bonn 1975. Seite 11.
[3] Geza Vermes, ANNO DOMINI (Ein Who’s Who zu Jesu Zeiten),
Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach 2008, die Seite 295)
DIE WELT DER KELTEN
AUTOR:: Josef Theobald
Einer der frühen Hochkulturen war die der Kelten. Die Griechen
nannten sie „Kelten“ oder „Galater“, die Römer „Gallier“ und wie
die Griechen „Kelten“. Sie selbst bezeichneten sich allerdings im
übertragenen Sinne als „die Tapferen“ und „die Erhabenen“.
Die ältere Kultur nennt man „Hallstatt-Kultur“ nach dem Fundort
im oberösterreichischen Salzkammergut. Hier waren Adlige oder
Fürstenpersönlichkeiten Träger dieser Kulturstufe. Die Kelten in
dieser Zeit lebten zwischen Burgund und Österreich. Sie ließen
sich aufwendig in großen Erdgrabhügeln beisetzen und lebten
in befestigten Höhensiedlungen.
Die spätere Kultur nennt man „La-Tène-Kultur“ nach dem Fundort
in der Schweiz am Westufer des Neuenburger Sees. Hier setzte
sich zwischen Ostfrankreich und Böhmen eine neue, nun latène-
zeitlich benannte Adelsschicht durch, deren Repräsentanten nicht
nur Männer, sondern auch Frauen, sein konnten. Vielleicht muss
man hier von einem Adelsgeschlecht sprechen, das sich um die
Personengruppen bildete, die der südlichen Hallstatt-Adelsschicht
entstammten und die eine neue wirtschaftliche Grundlage vor allem
in der gezielten Ausbeutung von Erzlagerstätten sahen. Denn in ei-
nigen Fällen liegen – heute noch erkennbar – zeitgleich befestigte
Höhensiedlungen, Adelsgräber und Erzlagerstätten recht nah bei-
einander, so dass man von einer Verbindung zueinander ausgehen
kann.
Die adligen Toten wurden im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. in meist
großen, auch exponiert gelegenen Erdhügeln beigesetzt und eben-
so mit dem modernen zweirädrigen Streitwagen mit Bronzegeschirr
und kostbaren Schmuck- und Trachtbestandteilen für das Jenseits
versehen. Aus einem Fürstengrab von Schwarzenbach (dem Orts-
teil von Nonnweiler im Kreis St. Wendel) kommt der meisterhafte
Goldblechbeschlag einer Schale, oder, eher wahrscheinlich eines
Trinkhorns oder eines Siebtrichters der 2. Hälfte des 5. Jahrhun-
derts v. Chr., der friesartig aneinander gereihte Ornamente zeigt.
Als Beispiel aus der Zeit um 400 v. Chr. sei ein fürstlicher Mann
aus dem Ort Weiskirchen (Landkreis Merzig-Wadern) genannt,
der mit kostbarem Gürtel- und Taschenschmuck, Fibeln und ei-
nem Prunkdolch als Zierwaffe beigesetzt worden war. Er trug die
für die Kelten charakteristische karierte Hose, die den klassischen
Völkern absolut fremd war. Ein Hals- und ein Armring stammten
aus einem keltischen Fürstinnengrab, das 1954 im saarländischen
Reinheim (Saarpfalz-Kreis) entdeckt wurden. Jene Schmuckstücke
werden auf die Zeit um 400 v. Chr. datiert.
In Wales, Nordschottland und Irland hat sich die keltische Sprache
bis heute erhalten. Der keltische Kunststil blieb bis ins Mittelalter be-
stehen. Im 1. Jahrhundert v. Chr. hatte sich auf den Britischen Inseln
ein eigenes keltisches Kunstempfinden ausgebildet, das unter dem
Einsatz des Zirkels die Gestaltung komplizierter Muster ermöglichte.
Die Schaffung der römischen Provinz „Gallia Narbonensis“ von den
östlichen Pyrenäen bis zum Westalpenrand und hinauf zum Genfer
See bedeutete das Ende zahlreicher befestigter einheimischer Hö-
hensiedlungen. Ihr mediterran geprägtes „Stadtbild“ mit geregeltem
Bebauungsplan, mit Straßen, Speichern und Zisternen, die Keramik
und die Verwendung der griechischen Schrift einerseits, die keltische
Art der Tracht und Bewaffnung andererseits, müssen im Laufe des 2.
Jahrhunderts v. Chr. nachhaltig auf die Anlegung ähnlicher Siedlungen
nordwärts davon gewirkt haben. Diese Siedlungen hatten aber ebenfalls
wie diese eine politisch-wirtschaftliche Mittelpunktsfunktion innerhalb ei-
ner Stammesgemeinschaft inne. Als Sitz der Verwaltung und der Rechts-
sprechung, als Ort des Stammesheiligtums boten sie Platz für handwerk-
liche Betriebe, waren Wohnsitz des Adels und Fluchtburg der umliegenden
Bevölkerung. Hier regierten die Könige oder adligen Häuptlinge, agierten
die Druiden und Krieger, arbeiteten privilegierte Handwerker, und es be-
stand noch genügend Raum für bäuerliche Tätigkeiten. Zusammen mit
dem umliegenden Einzugsgebiet stellten diese Oppida also in sich ge-
schlossene und voll funktionsfähige Siedlungseinheiten dar.
Doch auch diese Kultur ging bald wieder unter. Mittel- und nordeuro-
päische Barbarenstämme bildeten zusammen mit den Restkelten in
Mitteleuropa eine neue ethnische Gruppe, eben zu jener der Germa-
nen. Diese Stämme übernahmen exakt die gleiche historische Rolle,
die bis dahin die Kelten gespielt hatten. Germanen waren fortan An-
rainer der von den Römern getragenen hoch zivilisierten Mittelmeer-
welt, deren Grenzen – eben durch die Römer – inzwischen bis in den
mitteleuropäischen Raum vorgeschoben worden war.
Die Christianisierung der Kelten konnte deshalb so gut erfolgen, da
der soziologische Aufbau der Iro-Schotten dem der Kelten am Ober-
lauf der Donau entsprach. Hier wies die Herrschaftsstruktur eine Ver-
schmelzung blutsverwandter Gruppen auf, die von einer mächtigen
Familie beherrscht wurden, und die Kirchenorganisation folgte einem
ähnlichen Muster. Bedeutsam für die irische Kirche war die Rolle der
Frauen und die Gründung von Schwesternklöstern. Es gab aber auch
Doppelklöster, eines für Männer und eines für Frauen. Man teilte sich
hier eine Kirche, lebte nach denselben Regeln und unterstand der ge-
meinsamen Verantwortung durch eine Äbtissin und einen Bischofsabt.
Allerdings war dieser egalitäre Ansatz für Frauen nur von kurzer Dauer.
Hier im Gebiet der Saar spielte ein St. Wendelin oder ein Wendalinus
bei der Missionierung eine besondere Rolle. Dieser gilt in der 1. Hälfte
des 7. Jahrhunderts entweder als Stifter der Abtei Tholey oder als einer
der ersten „schottischen“ Äbte. Im Gefolge dieser herausragenden Per-
sönlichkeit tritt eine Nonne mit dem Namen „Oranna“ auf. Es gibt hier
Gelehrte, die da ein Geschwisterpaar sehen möchten. Dennoch zei-
gen die Umstände der frühen Klosterbildung, dass die keltische So-
zialstruktur förderlich für die Akzeptanz weiblicher Missionare war.
Mit dem wachsenden Einfluss der römischen Kirche kam auch ein
geändertes Frauenbild zu uns. Man favorisierte das Idealbild einer
unbefleckten oder unschuldigen Jungfrau, das aber im Judentum
keine Entsprechung hatte und eher im griechisch-römischen Um-
feld anzutreffen war.
QUELLENHINWEIS
Als Buchquellen wurden DIE GROSSE WELTGESCHICHTE,
Frühe Kulturen für Europa, erschienen in Lizenz BROCKHAUS
im Weltbild Verlag und das Buch von Christine Kinealy mit dem
Titel GESCHICHTE IRLANDS, das 2004 im Magnus Verlag in
Essen erschien, herangezogen.
WORTERKLÄRUNGEN
Ein „Druide“ ist ein keltischer Priester der heidnischen Zeit.
Das lateinische Wort „oppida“ ist der Plural des lateinischen
Substantivs „oppidum“ und bedeutet im Singular militärische
Befestigung und Verschanzung.
NACHTRAG
Welche Umstände begünstigten denn die Tatsache, dass es auf
keltischer Seite auch weibliche Fürsten gab? In den Werken des
Herrn Lenin aus Russland findet sich aber jedoch eine plausible
Erklärung:
„Es hat aber eine Zeit gegeben, da kein Staat existierte, da der
allgemeine Zusammenhalt, die Gesellschaft selbst, die Disziplin,
die Arbeitsordnung aufrechterhalten wurden durch die Macht der
Gewohnheit, der Traditionen, durch die Autorität oder Achtung,
die die Ältesten der Geschlechtsverbände oder die Frauen ge-
nossen, die zu dieser Zeit oftmals eine den Männern gleichbe-
rechtigte, ja nicht selten sogar höhere Stellung einnahmen, ei-
ne Zeit, da es keine besondere Kategorie von Menschen, keine
Spezialisten gab, um zu regieren.“ (Werke. Band 29, Dietz Ver-
lag, Berlin-Ost 1961, Seite 465)
BEITRAGSBILD
Das goldene Pferd von Reinheim
DAS KIRCHLICHE FEST ALLERHEILIGEN
AUTOR: Josef Theobald
Die Kelten feierten den Jahreswechsel in der Nacht zum 1. November.
Der Jahreswechsel wurde „Sam-Hain“ (= das Ende des Sommers) ge-
nannt. Sie gedachten dabei der toten Seelen. Zu diesem Fest sollen
große Feuer und das Opfern von Getreide und Tieren gehört haben.
Mit den Opfern sollten die Seelen der Verstorbenen besänftigt wer-
den.
Die Menschen im Römischen Reich sollen ebenfalls im Herbst ein
Fest in Erinnerung der Verstorbenen begangen haben, nämlich das
„Lemurenfest“. Lemuren waren die Seelen der Verstorbenen, welche
als Dämonen und Geister weiter die Lebenden begleiteten.
Die christliche Kirche assimilierte den vermutlich nicht auszurottenden
Brauch in einem Gedenktag für „alle heiligen Seelen“ = „Allerheiligen“.
Grundsätzlich gilt die gesamte christliche Gemeinschaft als heilig. Ver-
mutlich durch Übernahme einer um 150 v. Chr. im Judentum aufkom-
menden Märtyrer-Theologie (Märtyrer -griechisch- = Zeuge) haben
die mit dem Leben bezahlten Glaubenszeugen eine besondere heilige
Bedeutung erlangt. Jene, welche für ihr Zeugnis Folter, Verfolgung und
Entbehrung erlitten, werden „Bekenner“ genannt. [1]
„Allerheiligen“ ist in der katholischen Kirche das Sammelfest für alle
Heiligen am 1. November. Die Kirche gedenkt mit diesem Hochfest
nicht nur der vom Papst heiliggesprochenen Frauen und Männer,
sondern auch der vielen Menschen, die eher unspektakulär und
still ihren Glauben gelebt und ihr Christentum konsequent verwirk-
licht haben. [2]
Der älteste Beleg für diesen „Herrentag aller Heiligen“ findet sich im
4. Jahrhundert bei Johannes Chrysostomos. Er ist am Sonntag nach
Pfingsten datiert, da ursprünglich die Osterzeit mit dem Totengedenken
verknüpft war. Papst Bonifatius IV. weihte 609 das zuvor der heidnisch-
antiken Götterwelt zugeschriebene Pantheon in Rom der Jungfrau Maria
und allen Heiligen. Daraufhin wurde jedes Jahr am Freitag nach Ostern
den Heiligen gedacht.
In Irland entstand ab dem 8. Jahrhundert ein neuer Hintergrund für das
Heiligenfest: Der Zusammenhang mit Ostern verblasste allmählich, statt-
dessen rückte die sterbende Natur, durch die die ewige Welt der Heiligen
sichtbarer wird, in den Vordergrund. So wurde dort der 1. November der
neue Termin des Festes, zugleich Winterbeginn und Jahresanfang. Im
9. Jahrhundert brachten irische Missionare dieses Brauchtum auf den
Kontinent. Papst Gregor IV. dehnte den Gedächtnistag auf die ganze
Kirche aus. [3]
Nach dem Entstehen des Festes „Allerheiligen“ wurde das Fest im
Kloster und in der Kongregation von CLUNY unter dem Abt ODILO
(994-1048) als Totengedächtnis eifrig in Gebet und Opfer gepflegt.
Dies brachte eine Menge von Güterschenkungen ein. Daher wurde
das Kloster von CLUNY allmählich reich und mächtig. [4]
ANMERKUNGEN
[1] Hans-Peter Ebert, Festtage zum Nachlesen (Hintergründe
zu Zeitrechnung und Brauchtum), DRW-Verlag, Leinfelden-Ech-
teredingen 2001, Seiten 100 + 101.
[2] Manfred Becker-Huberti – Ulrich Lota, KATHOLISCH (A-Z),
Das Handlexikon, Verlag Herder, Freiburg (Breisgau) 2009,
Seite 15.
[3] Die wichtigsten Gedenk- und Feiertage (Religiöse und na-
tionale Feiertage weltweit), Chronik Bertelsmann, Wissen Me-
dia Verlag, Gütersloh/München 2009, Seiten 52 + 53.
[4] Bihlmeyer – Tüchle, Kirchengeschichte, Zweiter Teil: Das
Mittelalter, 12. Auflage, Verlag Ferdinand Schöningh, Pader-
born 1948, §§ 100,1 + 101,3.
DIE EINBINDUNG DER SAARSTRECKE IN DIE EIFEL- UND MOSELSTRECKE
AUTOR: Josef Theobald
Nach der Rückgliederung des Saarlandes in die
Bundesrepublik Deutschland zeigte sich, dass
bahntechnisch eine Einbindung in die Eifel- und
Moselstrecke notwendig wurde.
Zwei Bahnstrecken fuhren nach Köln. Die eine
Strecke ging über die Eifel. Die andere verlief
an der Mosel vorbei über Koblenz nach Köln.
Das bedeutete, dass in den Sechziger Jahren
leistungsstarke Diesellokomotiven eingesetzt
werden mussten, um die langen Distanzen zu
bewältigen. Mit den alten Dampflokomotiven
der Baureihe 38 war dies nicht zu schaffen.
Mit der Elektrifizierung 1973 gewann die Mo-
selstrecke immer mehr an Bedeutung. Durch
die Einführung des IC-Verkehrs von Koblenz
nach Köln wurde die Eifelstrecke immer mehr
abgehängt. Zwischen Trier und Koblenz verke-
hren heute Regionalexpresszüge (RE).
Die Elektrifizierung der Saarstrecke brachte
einen Gleichstand. Der Kölner Raum war nun
bald besser und schneller zu erreichen. Trier
gilt hier als ein Knotenpunkt.
Es gibt in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-West-
falen Überlegungen, auch die Eifelstrecke zu
elektrifizieren. Zumindest werden Teillösungen
diskutiert. Ob dies aber den langjährigen Rück-
stand wieder wettmachen kann, bleibt fraglich.
Einen Sinn hätte dies nur in einem touristischen
Konzept, das die Orte in der Eifel aufwertet.
BILD: zwei Diesellokomotiven der Baureihe
225 im Güterzugeinsatz
3. OKTOBER: TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT
AUTOR: Josef Theobald
Der Wunsch nach deutscher Einheit wurde in West-
deutschland stets hochgehalten. Die sozial-liberale
Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt (1913-
1992) hatte lediglich normale völkerrechtliche Be-
ziehungen zur ehemaligen DDR angestrebt.
In der Regierungszeit von Bundeskanzler Helmut
Kohl (1930-2017) gelang die erstrebte Wiederver-
einigung. Kohl sah sich als Vollender der Einheit.
In der früheren DDR dagegen sah man den gegen-
wärtig existierenden sozialistichen Staat allein als
legitim an. Seit den Sechziger Jahren hatte man
eine deutsche Wiedervereinigung verworfen. Es
wurde zu einem Tabu-Thema.
Mit den wirtschaftlichen und finanziellen Schwierig-
keiten trieb man die DDR-Bevölkerung in die vor-
mals abgelehnte Wiedervereinigung.
Nach dem Beitrtt der früheren DDR zur Bundes-
republik Deutschland kam es am 3. Oktober 1990
zur gemeinsamen Wahl des Bundestages. Der in
der Bundesrepublik gefeierte 17. Juni wurde auf
den 3. Oktober verlegt. Seitdem ist der 17. Juni
nur noch ein Gedenktag an die Arbeiterunruhen
im Jahre 1953 in Ost-Berlin.
Die politische Lage der früheren DDR war durch
den bürokratischen Staatsmonopolkapitalismus
geprägt. Dazu kam eine weit verbreitete Korrup-
tion. Durch die Staatssicherheit politisch verfolgt
wurden Minderheiten, wie junge christliche Ge-
meinden, Umweltgruppen, Ausreisewillige und
Anhänger anderer kommunistischer Parteien.
Die wirtschaftliche Lage war sehr angespannt.
Die Subventionen des täglichen Lebens, wie
gedeckelte Mieten, günstige Energiekosten
und verbilligte Lebensmittelpreise, konnten
plötzlich durch die erzielten Steuereinnahmen
aus den Gewinnen der verstaatlichten Betriebe
(VEB) nicht mehr finanziert werden.
Der Export in die Länder des RGW ging zurück.
Die Sowjetunion verstand es, die festgesetzten
Verrechnungspreise zu ihren Gunsten zu ver-
ändern. Dadurch stiegen die Preise für Erdöl.
In der Periode der Perestroika (Reorganisation)
hatte die Sowjetunion erhebliche wirtschaftliche
Schwierigkeiten. Sie konnte ihre Abnahmever-
pflichtungen nicht mehr einhalten. Die DDR-
Betriebe produzierten nur noch auf Halde.
Nach der Wiedervereinigung wollten die Bürger
der ehemaligen DDR schnell die D-Mark haben.
Dies sorgte aber dafür, dass der Wert der DDR-
Betriebe erheblich absank. Denn die Mark der
DDR war etwa 2/3 weniger Wert. Auf diesem
Niveau hatte die frühere DDR produziert. So
war sie gegenüber anderen RGW-Staaten
konkurrenzfähig. Mit der Einführung der D-
Mark waren die neuen Bundesländer plötz-
lich nicht mehr in dieser Lage. Die Qualität
der Produkte, der vorhandene Investitions-
stau und die Kostensituation machten die
ehemaligen DDR-Betriebe nicht mehr wett-
bewerbsfähig. Dementsprechend sind sie
von der Treuhand abgewickelt worden.