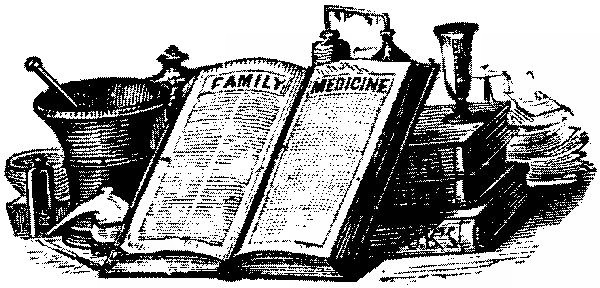AUTOR: Josef Theobald
Als Beispiel für das Hospitalwesen im Rheinland kann die Bischofs- und
Hansestadt Münster gelten. Hier hatte sich im Gegensatz zu den meisten
Städten die Armenfürsorge dezentral entwickelt. Um 1550 gab es dort 13
Armenhäuser. Zwei von ihnen standen als Zwölfmännerhäuser unter der
Aufsicht des Domkapitels. In ihnen wurden Diener und Knechte der Dom-
herren bzw. der Höfe des Domkapitels aufgenommen. Die anderen Häu-
ser, unter ihnen das erstmals 1176 erwähnte Magdalenen-Hospital und
das nach 1350 gegründete Armenhaus „Zur Aa“, die jeweils 33 Personen
aufnehmen konnten, hatten insgesamt eine Aufnahmekapazität von ca.
190 Personen, die nicht (mehr) arbeitsfähig waren. Daneben gab es die
offene Armenfürsorge („Almosenkörbe“, „Speckpfründe“) in den einzelnen
Kirchspielen, das Gasthaus für durchreisende Fremde, das vor der Stadt
gelegene Leprosenhaus „Kinderhaus“ sowie vier Elende, die im Bedarfs-
fall für die an Pest erkrankte Münsteraner Einwohner sowie schließlich für
Durchreisende geöffnet wurden.
Voraussetzung für die unentgeltliche Aufnahme auf Lebenszeit waren so-
wohl eigene Verdienste zugunsten ihrer Heimatstadt als auch die Stiftung
des Nachlasses zugunsten des Hospitals zu ihrem Seelenheil. Eine zweite
Aufnahmeform war die allgemein bekannte Verpfründung, bei der ein ein-
gezahlter Betrag die Kammer und die Verpflegung bis zum Tode sicherte.
Eine dritte Möglichkeit bestand darin, zunächst als Gastmeister zu arbei-
ten, eine Summe einzuzahlen und danach zu entscheiden, ob man im
Hause wohnen bleiben wolle. Zog man aus, so erhielt man für seine ge-
leistete Arbeit eine Rente. Zudem war viertens eine vorübergehende Auf-
nahme nachweisbar, die mit einer gestifteten Erbrente abgegolten wurde.
Aufgenommen wurden bedürftige arme Personen, die sich nicht mehr mit
ihrer Arbeit ernähren konnten, keinen anderen Trost hatten und so krank
waren, dass sie nur mit Krücken an den Türen guter Leute um Brot betteln
konnten. Für den Stifter des Hospitals wurde stets gebetet. Auch hatten die
Armen dem Provisor (Verwalter) Gehorsam und Friedfertigkeit zu schwören.
Bei erfolgter Gesundung sowie bei ungebührlichem Verhalten mussten sie
das Hospital wieder verlassen. In jedem Fall bestand ein Anfallsrecht des
Hospitals auf den Nachlass des verstorbenen Armen. Dazu kamen Arbeits-
verrichtungen für das Hospital. Im Magdalenen-Hospital waren diese ange-
siedelt beispielsweise in der Schlachtung, beim Brauen und bei Gartenar-
beiten. Aus dem Armenhaus „Zum Busch“ in Münster ist bekannt, dass die
untergebrachten Hausbewohnerinnen mit der Herstellung von Kerzen für
den Bedarf der benachbarten Martinskirche betraut waren. [1]
Die Verwaltung eines Spitals hatte eine Laienbruderschaft, an deren Spitze
ein von den Brüdern gewählter Spitalmeister (magister hospitalis) stand. Sie
lebten nach der Augustinerregel und nach vom Bischof erlassenen Konstitu-
tionen. Außerdem waren u. a. Bader im pflegerischen Bereich tätig. An der
Spitze aller stand eine Spitalmeisterin, die für den Großhaushalt, für die ver-
sorgende Garten-, Vieh- und Landwirtschaft sowie für die seelsorgerliche Be-
treuung, einschließlich für einen eingesetzten Schulmeister, zuständig war.
In Saarlouis herrschte eine niederdeutsche Tradition vor, die man aus
Flandern importierte. Hier ging man dazu über, wie in anderen Städten
ein Gesundheitswesen unter kommunaler Aufsicht aufzubauen. [2]
Im Gebäude des alten Canisianum, ursprünglich nach der Gründung der
Stadt eine Kirche mit Kloster der Augustinereremiten des Wallerfanger
Konvents, wurde nach der Französischen Revolution in preußischer Zeit
1840 ein neues Hospital errichtet, das nach einer Verlegung des Städti-
schen Krankenhauses im Jahre 1929 wieder als Anwesen eines Jesu-
itenordens diente. Ergänzend hinzu kam die Ansiedlung der Borromäe-
rinnen aus Nancy durch einen Vertrag aus dem Jahre 1810, die hier ein
„Hospice de Charité de Sarrelouis“ errichteten. Dazu kam in den Jahren
von 1833 – 1846 eine Mädchenschule, die von der Oberin Xavier Rudler
geleitet wurde. Nach der Gründung einer Krankenpflegeeinrichtung in der
Bierstraße zog man 1841 in die Augustinerstraße um. Das Hospital wurde
hier ausgebaut und 1867 durch ein Männerkrankenhaus erweitert. Neben
der Krankenpflege kam es 1859 zum Betrieb einer Höheren Töchterschule.
Ein Jahr später kam eine Waisenschule hinzu. 1890 schenkte dann Delphin
Motte dem Orden ein weiteres Gebäude, in dem dieser ein „Mägdeheim“,
eine Industrieschule und eine Kinderbewahrschule errichtete. Die Kinder-
bewahrschule zog 1908 in einen neuen Gebäudetrakt in der Augustiner-
straße; das Krankenhaus wechselte in die Räumlichkeiten des heutigen
DRK-Krankenhauses. Nach der Aufgabe verschiedener Einrichtungen
verließen allerdings die Schwestern 1939 Saarlouis. Seit 1848 leiten
die Borromäerinnen das St. Nikolaus-Hospital in Wallerfangen.
1875 kamen die Franziskanerinnen von Waldbreitbach nach Saarlouis
und gründeten hier an Ostern 1902 die heutige St. Elisabeth-Klinik. [3]
ANMERKUNGEN [1] Gisela Drossbach (Herausgeberin), HOSPITÄLER IN MITTELALTER UND FRÜHERER NEUZEIT (Frankreich, Deutschland und Italien. Ei- ne vergleichende Geschichte), R. Oldenbourg Verlag, München 2007, Seiten 25 – 39. [2] wie [1], jedoch die Seiten 53 + 258. [3] Quelle: WIKIPEDIA, Webseite der Kreisstadt Saarlouis und des Ma- rienhaus Klinikums Saarlouis-Dillingen (Unsere Geschichte).