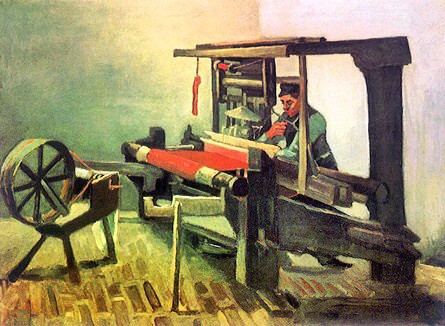AUTOR: Josef Theobald
Leinenweber verarbeiteten ursprünglich sowohl den gesponnenen Flachs
als auch Hanf zu Leinwand; seit etwa 1500 wurde Hanf hauptsächlich nur
noch für Haustuch, Sack- und Packleinwand, grobe Zeuge wie Segeltuch
und Seilwaren verwendet. Im Gegensatz zur Tuchmacherei (Wollweberei),
die sich doch meist als städtisches Handwerk etablierte, war dagegen die
Leinenweberei lange Zeit im ländlichen Raum als Heimgewerbe verbreitet
und wurde vielfach von hörigen Bauern und Tagelöhnern betrieben. Leinen-
weber war im Mittelalter ein hochgeschätztes Gewebe, aus dem nicht nur
Hemden und Bettzeug, sondern auch Kleider, Waffenröcke, Satteldecken,
Hutbezüge und Paniere verfertigt wurden. [1]
Das Gewerbe der Leinenweberei war ursprünglich ein Nebengewerbe der
Landwirtschaft. Doch mit der steigenden Mannigfaltigkeit und Kunstfertig-
keit der Produktion konnte das bisher betriebene Nebengewerbe nicht
mehr von denselben oder einzelnen Personen ausgeübt werden. So
sonderte sich das Handwerk vom Ackerbau. Mit der Spaltung der Pro-
duktion in zwei große Hauptzweige, Ackerbau und Handwerk, entsteht
die Produktion direkt für den Austausch, die Warenproduktion; mit ihr
der Handel, nicht nur im Innern und an den Stammesgrenzen, sondern
auch schon über See. [2]
Im 18. Jahrhundert nahm das Landhandwerk allgemein zu. Grund dafür
war in erster Linie die Notwendigkeit der Beschäftigung einer wachsen-
den Zahl von Menschen zwecks Bestreitung ihres Unterhalts durch den
Nebenerwerb oder den Übergang zu heimgewerblicher Produktion. Das
Einkommensniveau blieb aber nach wie vor gering. [3]
Die Voraussetzung für die Leineweberei ist der Flachsanbau. Hier bleibt
der größte Teil der Einkünfte entweder bei den Aufkäufern oder bei den
Verpächtern von Boden hängen. Die größeren Flachsaufkäufer richteten
Trockenräume und Pressen ein; sie dingten Arbeiter zum Sortieren und
Schwingen des Flachses. Dabei muss angeführt werden, dass die Bear-
beitung des Flachses besonders viel Arbeitskräfte erforderte. Dies führte
schließlich dazu, dass der Landwirt in der Winterzeit mehr beschäftigt war,
andererseits schaffte dies eine Nachfrage nach Lohnarbeit auf der Seite
der Gutsbesitzer und wohlhabenden Bauern, die Flachs anbauten. [4]
Typisch für den Vertrieb war hier das Verlagssystem. Dabei traten Kauf-
leute mit kleinen gewerblichen Produzenten in Verbindung. Somit blieb
die Produktion dezentral. Der Absatz der erzeugten Produkte sowie de-
ren Weiterverarbeitung ist zentral erfolgt. Zentral beschafft wurde auch
das Rohmaterial. Diese Entwicklung ergab sich aus der Notwendigkeit,
wachsende und entfernte Märkte zu versorgen.
Die Arbeitstechnik der Leineweberei wurde meist von den Eltern auf ihre
Kinder weitergegeben. Denn im Arbeitsprozess war Kinderarbeit Alltag.
Dadurch wurde eine Steigerung der Produktion erreicht. Diese Arbeits-
weise nennt man auch „proto-industrielle“ Familienwirtschaft, die in den
Zeiten schlechter Preise und geringen Absatzes gezwungenermaßen
und selbstverständlich zur Selbstausbeutung überging. Diese kleinen
gewerblichen Produzenten lebten in Häuslerhäusern auf bäuerlichem
Grund, zum Teil abgesetzt vom Dorf in eigenen Häusern (Hüttchen).
Wohnten sie in den Dörfern, gehörten sie allerdings nicht zur Dorf-
gemeinde. War die Produktion verlagsmäßig organisiert und wurden
vom Verleger Werkzeug und Rohstoffe gestellt, so näherte sich der
Status eines Heimarbeiters dem des lohnabhängigen Manufakturar-
beiters. In der Praxis ist es aber auch vorgekommen, dass ein ge-
werblicher Kleinproduzent doch zu bescheidenem Wohlstand und
zu der Stellung eines Zwischenmeisters im Verlagssystem gekom-
men ist. Zu einem Verleger selbst ist er oft kaum aufgestiegen.
In stadtfernen Gebieten, wo sich dieses Gewerbe verdichtete, hat
diese Bevölkerungsgruppe offensichtlich ein Eigenleben geführt.
Denn man heiratete vorwiegend untereinander und gründete je-
weils wieder eine Spinner- und Weberfamilie. [5]
Wie das Beispiel der oberösterreichischen Leinenindustrie zeigt, kon-
nte dieser Zweig an der inländischen Textilkonjunktur des späten 18.
Jahrhundert teilhaben, was durch die Freigabe der Leinenweberei auf
dem Lande 1755/73 begünstigt wurde. Der Aufschwung brach aber um
etwa 1800 auf einmal ab, wohl im Zusammenhang mit der plötzlich über-
mächtig gewordenen Konkurrenz der Baumwollindustrie, der die Leinen-
industrie wenig entgegenzusetzen hatte. Ebenfalls gingen während der
napoleonischen Zeit der Überseemarkt und das Westgeschäft zur Gänze
verloren. Leinen, einstmals das wichtigste nicht-landwirtschaftliche Export-
gut der Habsburgermonarchie, wurde im frühen 19. Jahrhundert fast nur
mehr für das Inland erzeugt, wenn es überhaupt auf den Markt kam. [6]
Schon Friedrich Engels wies in seinem Vorwort zur zweiten Auflage der
Schrift „Zur Wohnungsfrage“ darauf hin, dass die Leinenweberei zu der
Zeit, als sie für den Weltmarkt arbeitete, schon soweit durch die Steuern
und Feudallasten erdrückt wurde, dass sie den webenden Bauer nicht
über das sehr niedrige Niveau der übrigen Bauernschaft erhob. [7]
NACHTRAG
In Saarlouis-Roden haben wir eine Leineweberstraße zwischen der
Lindenstraße und der Ellbachstraße. So deutet heute alles darauf
hin, dass sich ursprünglich diese Straße in früheren Jahrhunderten
außerhalb der eigentlichen Besiedlung befand. Nach dem II. Welt-
krieg waren die hier befindlichen Häuser meist vollständig zerstört
und wurden schließlich in den Fünfziger Jahren im Stil der Wieder-
aufbaujahre neu errichtet. Das Haus mit der Nr. 7 hatte fast noch
den alten Stil der Häuslerhäuser. Nach einem erfolgten Umbau ist
der alte Baustil heute leider nur noch zu erahnen.
Verlag, Berlin-Ost 1966, Seite 287.
sche Geschichte 6), 2. ergänzte Auflage, Kleine Vandenhoeck-Rei-
he, Göttingen 1984, Seite 38.
Russland, Dietz Verlag, Berlin-Ost 1956, Seiten 286/87.
Roman Sandgruber, Verlag Ueberreuter, Wien 1995, Seite 184.
Dietz Verlag, Berlin-Ost 1966, die Seite 521.