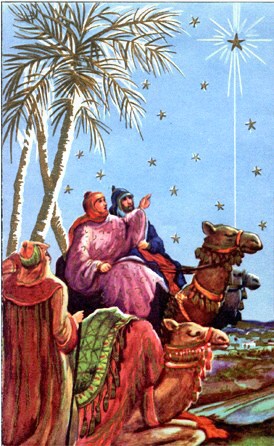AUTOR: Josef Theobald
In der Volksfrömmigkeit des Mittelalters traten mehr und mehr die
Heiligen Drei Könige in den Mittelpunkt dieses Festtages, so dass
Epiphanie (die Erscheinung des Herrn) im deutschen Sprachraum
fast nur noch Dreikönigsfest genannt wird. [1]
Die „Heiligen Drei Könige“ sind eine jüngere Erfindung. Diese geht
auf Matthäus 2,1-12 zurück, wo Magier von Osten nach Jerusalem
ziehen, um den neugeborenen König der Judaier zu suchen, indem
sie seinem Stern folgten, um ihm zu huldigen. Nach Herodot waren
die Magier (griechisch „magos“) ein persischer Stamm mit priester-
lichen Funktionen, der sich auf die Erklärung von Phänomenen am
Himmel verstand (Sterndeuter). Bei den im Matthäus-Evangelium
erwähnten Magiern handelt es sich um weise Männer, die mit der
jüdischen Welt nicht vertraut waren. [2]
560 ist erstmals in einem Mosaik in Ravenna die Zahl „drei“ belegt
und sind deren Namen genannt: Kaspar, Melchior und Balthasar.
Um 800 – 900 wurde Balthasar dunkelhäutig. Allmählich wurde der
Tag zum missionarisch bedeutenden Feiertag umgestaltet, denn
erstmals beugten an diesem Tag nicht-jüdische „Heiden“ ihre Knie
vor Jesus.
Anscheinend lag hier ein armenisches Märchen zugrunde, das um
das Jahr 500 entstand und von der Kindheit Jesu berichtete, in der
drei Könige (Melkon aus Persien, Gaspar aus Indien und Baltassar
aus Arabien) eine Rolle spielten. In der Anlehnung an Psalm 72,10
hatten die Könige von Tharsis (die phönizische Kolonie „Tartessus“
in Spanien) und von den Inseln Gaben (Geschenke) gebracht. Die
Könige von Scheba (in Südarabien) und Saba (Äthiopien) schafften
den Tribut herbei. [3]
Diese oben genannten weit entfernt liegenden Gebiete wurden nicht
etwa erobert aufgrund persönlichen Machtstrebens, aus Verlangen
nach Weltruhm oder ähnlichen Gründen, sondern sie schlossen sich
der Herrschaft allein wegen des einzigartigen gerechten Regiments
König Salomos an. [4]
Die von den Weisen (Magiern) überbrachten Gaben waren Gold,
Weihrauch und Myrrhe. Nur für die wenigen Wohlhabenden aus
Palästina brachten Karawanen Gold. Für den Tempeldienst sind
notwendigerweise Weihrauch, der nur in Arabien zu finden war,
und Myrrhe eingeführt worden. [5]
Im Laufe der Zeit wurden die „drei Könige“ zu Schutzpatronen für
Reisende, Pilger und Gastwirte. Daher haben sich viele Gastwirt-
schaften entsprechende Namen gegeben: „Drei König“, „Krone“,
„Zur Krone“, „Zum Sternen“ und „Zum Mohren“.
Wie wenig wichtig Fakten für unser persönliches Empfinden gegen-
über solchen „Märchen“ sind, zeigen die „Sternsinger“, die alljährlich
als Caspar, Melchior und Balthasar von Haustür zu Haustür wandern,
welche für einen guten Zweck Geld sammeln und auch das Haus der
besuchten Spender segnen. Sie schreiben die Buchstaben C + M + B
über die Haustür. Diese Buchstaben sind eine lateinische Abkürzung
von „Christus Mansionem Beneficat“ und bedeuten: „Christus segne
das Haus“. [6]
ANMERKUNGEN
[1] Manfred Becker-Huberti / Ulrich Lota, KATHOLISCH
(A-Z), Das Handlexikon, Verlag Herder, Freiburg (Breis-
gau) 2009, Seite 65.
[2] Xavier Léon-Dufour, WÖRTERBUCH ZUM NEUEN TESTAMENT,
Kösel Verlag, München 1977, Seite 290.
[3] E. Kautzsch / A. Bertholet, DIE HEILIGE SCHRIFT DES
ALTEN TESTAMENTS, Zweiter Band, Verlag von J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck), Tübingen 1923, Seite 197.
[4] BROCKHAUS, Kommentar zur Bibel (2), Wuppertal 1980,
Seite 599.
[5] Arye Ben-David, Talmudische Ökonomie (Die Wirtschaft
des jüdischen Palästina zur Zeit der Mischna und des Tal-
mud), Band I, Georg Olms Verlag, Hildesheim–New York 1974,
die Seiten 228/29.
[6] Hans-Peter Ebert, Festtage zum Nachlesen (Hintergründe
zu Zeitrechnung und Brauchtum), DRW-Verlag, Leinfelden-Ech-
terdingen 2001, Seiten 49 – 51.